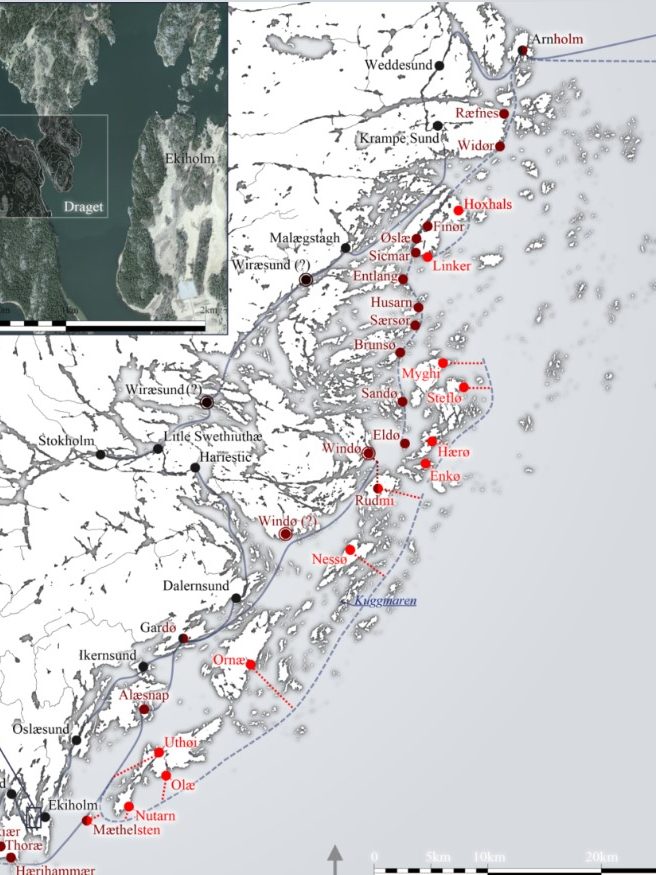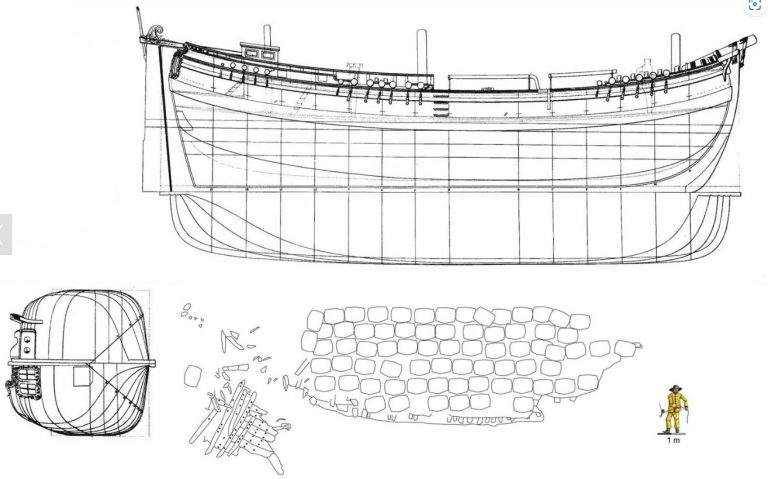Rückschau Vorträge 2025
Eine Burg im Schatten von Bettenburgen
Die aktuellen Forschungen zur Ruine Glambek auf Fehmarn
Montag, den 27. Januar 2025
um 19:30 Uhr
Online-Vortrag
von Lorenz Luick und Lukas Eckert (Hamburg)
Lorenz Luick erklärt das Profil während der AGSH-Führung im Okt 2024; Foto: P. Portalla
Die Burgruine Glambek, gelegen auf der Landzunge im Süden Fehmarns, ist ein einzigartiges Zeugnis der Burgenlandschaft Schleswig-Holstein, da sie als einzige Burganlage des Landes noch Ziegelmauerwerk aufweist. Historische Quellen verbinden die Burg mit bedeutenden Akteuren wie den dänischen Königen Christoph II. und Erik VII. und den Holsteiner Grafen Johann III. und Adolf VIII., doch konkrete Belege sind rar. Erste urkundliche Erwähnungen stammen aus dem Jahr 1318, als die Burg als Pfandobjekt diente. Im 14. und 15. Jahrhundert war Glambek mehrfach Schauplatz von Machtkämpfen zwischen dänischen Königen, holsteinischen Grafen und anderen regionalen Mächten. Ihre militärische Bedeutung schwand im 16. Jahrhundert, und spätestens nach dem Dreißigjährigen Krieg verlor die Anlage ihre Funktion und verfiel zur Ruine.
Archäologisch wurde die Burg erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts untersucht, jedoch gingen die Funde verloren, und die Dokumentation blieb lückenhaft. 2024 wurden die Forschungen durch die Universität Hamburg wieder aufgenommen, zunächst mit einer geomagnetischen Untersuchung der Burg und im Herbst mit einer ersten Lehrgrabung. Dabei konnten zahlreiche bauliche Reste identifiziert werden, darunter Mauerzüge, Brunnen und Spuren bisher unbekannter Strukturen. Die ersten Ergebnisse zeigen bereits, dass trotz der sichtbaren Zerstörung unterirdisch noch gut erhaltene Befunde existieren, die wertvolle Einblicke in die Baugeschichte und Nutzung der Burg ermöglichen könnten.
Die geplanten weiteren Untersuchungen sollen offene Fragen klären, etwa zu möglichen Spuren einer Nutzung vor dem 14. Jahrhundert oder zu Konflikten und Umbauphasen. Die bisherigen Ergebnisse belegen den hohen Denkmalwert der Anlage und ihre Bedeutung für die regionale Geschichte.
Zu den Vortragenden
Lorenz Luick M.A. hat Ur- und Frühgeschichte sowie Geschichte mit Schwerpunkt „Regionalgeschichte Schleswig-Holstein“ an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel studiert. Seit 2018 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie in Hamburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Mittelalterarchäologie und die Archäologie des 20. Jahrhunderts.
Lukas Eckert B.A. studiert Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie an der Universität Hamburg. Seit 2016 ist er an unterschiedlichen Projekten des Instituts maßgeblich beteiligt. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf der Anwendung geophysikalischer Methoden, der Vermessung und der digitalen Dokumentation und der Nutzung von Geoinformationssystemen in der Archäologie.
Die Videovorträge laufen über einen Videokonferenzdienst von Dataport. Der Eintritt ist jeweils über diesen Link möglich:
AGSH | Jitsi Meet (openws.de): https://video.openws.de/AGSH
Wichtig ist, dass Sie auf Ihrem Rechner, Tablet oder Smartphone möglichst den neuen Edge-Browser von Microsoft haben, sonst könnte es Schwierigkeiten mit der Verbindung geben.
Wir freuen uns auf Sie!
Gäste sind uns immer herzlich willkommen!!
Ruine Glambek, Fehmarn Foto: P. Portalla
Die Ausgrabungen auf dem Northvoltgelände in Lohe-Rickelshof
Archäologie der Superlative
Montag, den 24. Februar 2025
um 19:30 Uhr
Online-Vortrag
von Eric Müller (Schleswig)
Am Montag, dem 24. Februar 2025, um 19.30 Uhr, treffen uns wieder online!
Eric Müller (Schleswig) berichtet über „Die Ausgrabungen auf dem Northvoltgelände in Lohe-Rickelshof - Archäologie der Superlative“18490 Befunde, rund 4600 Jahre menschlicher Spuren auf über 9 ha – das ist die beeindruckende Bilanz der 1,5 Jahre dauernden Hauptuntersuchung in Lohe-Rickelshof. Im Vorfeld des geplanten Baus einer Batteriefabrik der Firma Northvolt führte das ALSH archäologische Untersuchungen durch. Die aufgrund der Voruntersuchungen ausgewählte archäologisch interessante Fläche liegt auf dem Geestrücken am Übergang zur westlich angrenzenden Marsch. Die hohe Dichte und Qualität der Befunde sowie die außergewöhnlich guten Erhaltungsbedingungen auf einer Fläche dieser Größenordnung sind in Schleswig-Holstein bislang beispiellos. Sie werden unser Verständnis der Region nachhaltig bereichern Die Befunde reichen vom Neolithikum (ca. 4100 v. Chr.) bis in die Völkerwanderungszeit (ca. 600 v. Chr. bis 0). Die Aufarbeitung ist in vollem Gange und hat bereits einige Überraschungen zutage gebracht – und es werden sicher noch weitere folgen.
Zum Vortragenden
Eric Müller M. A. hat Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Geschichts-wissenschaften und Philosophie studiert. Anschließend war er als Ausgrabungsleiter und Mitarbeiter an den Landesämtern für Archäologie Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie am Bereich Archäologie der Hansestadt Lübeck und als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Technischen Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern tätig. Seit 2016 ist er Ausgrabungsleiter am Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein.
Der Videovorträge laufen über einen Videokonferenzdienst von Dataport. Der Eintritt ist jeweils über diesen Link möglich:
https://video.openws.de/AGSH
Wichtig ist, dass Sie auf Ihrem Rechner, Tablet oder Smartphone möglichst den neuen Edge-Browser von Microsoft haben, sonst könnte es Schwierigkeiten mit der Verbindung geben.
Rückschau Vorträge 2024
König Waldemars Ostsee-Itinerar im Licht archäologischer Quellen
Montag, den 29. Januar 2024
um 19:30 Uhr
Online-Vortrag
von Dr. Daniel Zwick (Schleswig)
In diesem Vortrag wird eine königlich-dänische Beschreibung eines Seeweges aus dem 13. Jahrhundert von Utlängan nach Tallinn in einen historisch-archäologischen Kontext gestellt, wobei der Schwerpunkt auf mittelalterlichen Schiffswracks und Ortsbezeichnungen entlang dieser Route liegt. Basierend auf der Bauweise, dendrochronologischen Ergebnissen und Ladungsresten können für einige Wracks Rückschlüsse auf Herkunfts- und Zielhäfen gezogen werden. Ein Vergleich mit dem Hansischen Seebuch aus dem späten 15. Jahrhundert verdeutlicht die große Bedeutung der terrestrischen Navigation im Ostseeraum.
Im Spätmittelalter wurde die Ostsee zum Synonym für das „Hausmeer“ der Hanse. Die Grundlage für den hanseatischen Aufstieg im Seehandel wurde mit der Kooperation zwischen Ecclesia und Mercatura – Kirche und Kaufleute – im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert gelegt und kann daher direkt mit dem Urbanisierungsprozess infolge der Nordischen Kreuzzüge in Verbindung gebracht werden, für die dieser Seeweg von großer Bedeutung war.
Zum Vortragenden
Dr. Daniel Zwick spezialisierte sich auf die Schiffsarchäologie im Rahmen des Masterstudienganges zur „Maritime Archaeology“ an der University of Southampton. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit in der Rettungsarchäologie, u. a. eine Wrackausgrabung für die Landesarchäologie Bremen und verschiedene Rettungsgrabungen in Großbritannien und Irland, promovierte er an der Universität Kiel zum Thema „Maritime Logistics in the Age of the Northern Crusades“ in Zusammenarbeit mit dem Wikingerschiffsmuseum Roskilde und der Süddänischen Universität. Während der Promotionszeit absolvierte er eine Ausbildung zum Forschungstaucher und war in mehreren unterwasserarchäologischen Projekten im In- und Ausland involviert. Seine Projekte führten ihn auch auf das Orlopdeck des im Jahre 1628 gesunkenen und 1961 gehobenen schwedischen Kriegsschiffs VASA, auf dem er Vermessungsarbeiten durchführte. Seit 2016 ist er in verschiedenen Bereichen für das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein tätig, u. a. im BalticRIM Projekt (2017–2020) zur Einbindung des Kulturerbes der Ostsee in die Maritime Raumplanung, sowie in der Drittmittelbeschaffung und Konferenzplanung. Neben diesen Aufgaben untersuchte er auch die neuzeitlichen Wrackfunde aus dem Nordfriesischen Wattenmeer, die zwischen 2016 und 2022 durch Küstenerosion und Stürme freigespült wurden. Im Moment hat er die Leitung der Unterwasseruntersuchungen im Fehmarnbelt im Rahmen der Fehmarnbeltquerung inne.
Das Hanseschiff
Zur Archäologischen Ausgrabung von Lübecks erstem Schiffswrack
Montag, den 26. Februar 2024
um 19:30 Uhr
Online-Vortrag
von Dr. Felix Rösch (Lübeck)
Der Unterwasserarchäologe der Hansestadt Lübeck, Dr. Felix Rösch, berichtet über Ablauf und erste Ergebnisse der im Sommer 2023 durchgeführten Bergung von Lübecks erstem Schiffswrack. Das in die späte Hansezeit datierende Schiff war vollbeladen auf dem Weg zum Lübecker Hafen, bevor es kurz vor den Toren der Stadt in der Trave versank. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Schiff in einer bislang im Ostseeraum so noch nicht angetroffenen Bauweise gefertigt worden ist. Neben der vollständigen, aus 160 Fässern bestehenden Ladung, konnten die Archäologen auch eine Reihe von Funden aus dem Schiffsalltag bergen.
Zum Vortragenden
Dr. Felix Rösch studierte Ur- und Frühgeschichte, Geografie und Europäische Ethnologie in Kiel und in Basel. In Kiel legte er auch die Prüfung zum Forschungstaucher ab. In seiner Magisterarbeit beschäftigte er sich der mittelalterlichen Wüstung von Malente-Grellenkamp. Während seiner Promotion war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ur- und Frühgeschichte in Kiel und Museum für Archäologie Schloss Gottorf tätig und arbeitete an dem von der VW-Stiftung geförderten Projekt „Zwischen Wikingern und Hanse. Kontinuität und Wandel des zentralen Handelsplatzes Hedeby/Schleswig im 11. Jahrhundert“. Er schloss seine Dissertation mit dem Titel „Das Hafenviertel von Schleswig im Hochmittelalter. Entstehung, Entwicklung und Topografie“ ab. Anschließend arbeitete er als Forschungstaucher, Lehrbeauftragter und wissenschaftlicher Mitarbeiter in Peenemünde, Kiel, Halle-Wittenberg und Göttingen. Seit 2023 ist er als Wissenschaftler und Forschungstaucher im Bereich Archäologie und Denkmalpflege in Lübeck beschäftigt. Er ist Preisträger des AGSH-Archäologiepreises 2013 der Manfred-Blödorn-Familienstiftung.
Eine Siedlung und ein Stück vom Ochsenweg
Online-Vortrag
von Dr. Alexander Maaß (Schleswig)
Im letzten Jahr führte das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein in Kropp Ausgrabungen auf der Fläche der Gewerbegebietserweiterung durch. Bei Voruntersuchungen im Jahr 2022 hatten sich Hinweise auf Häuser aus der Völkerwanderungszeit (3. bis 5. Jh. n. Chr.) ergeben, die die aktuellen Ausgrabungen erforderten. Während der Ausgrabung konnten neben zwei Einzelhäusern mit unbekannter Funktion, 12 Gehöfte mit Wohnstallhaus, Zaunanlage, mehreren Nebengebäuden, darunter Grubenhäusern und zugehörigen Brunnen freigelegt und dokumentiert werden. Bei mehreren Gehöften konnten besondere Funktionen nachgewiesen werden: zum Beispiel ist eines als Schmiede anzusprechen, in der auch Edelmetall verarbeitet worden ist, während ein zweites Gehöft eher den Charakter eines Zentralbaus des Dorfes hat. Der Erhaltungszustand der Befunde war sehr gut, sodass die Anlagen vollständig und detailliert rekonstruiert werden konnten. Eine weitere überraschende Entdeckung waren Wagenspuren auf der Trasse des Ochsenweges. Die Spuren sind jedoch deutlich älter, da sie von zwei völkerwanderungszeitlichen Häusern überbaut wurden. Dies ist jedoch nicht verwunderlich. Der Ochsenweg (auch Heerweg genannt) ist eine historisch bedeutsame Nord-Süd-Route über die jütische Halbinsel von Viborg in Dänemark nach Wedel bei Hamburg. Er ist eines der wenigen Bodendenkmale, das in ungebrochener Kontinuität vermutlich seit der Steinzeit genutzt wurde. Sein Verlauf lässt sich noch heute anhand zahlreicher Hügelgräber entlang des Weges nachvollziehen. Einige wenige Stellen (Kropper Busch, Lürschau, beide denkmalgeschützt) vermitteln noch heute den Eindruck des historischen Aussehens der unbefestigten Wegetrasse. Abgesehen von dem kleinräumigen Nachweis von Fahrspuren am Tor des Danewerkes in der Gemeinde Dannewerk ist es nun erstmals in Schleswig-Holstein gelungen, einen ca. 50 m langen und ca. 20 m breiten Abschnitt mit erhaltenen Fahrspuren aus vorgeschichtlicher Zeit freizulegen.
Zum Vortragenden
Dr. Alexander Maaß studierte Urgeschichtliche Archäologie an der Universität Freiburg. Er promovierte zum Thema "Bergbau und seine sozioökonomischen Strukturen im Neolithikum/Chalkolithikum". Mitarbeiter in verschiedenen Projekten des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum. Anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt “Denkmalatlas in Niedersachsen. Darüber hinaus ist Alexander Maaß mit der Durchführung montanarchäologischer Ausgrabungen in Europa weit gereist: Mauretanien, Marokko, Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich, Griechenland, Bulgarien, Türkei, Oman. Besondere Einzelprojekte waren: mittelalterlicher Bergbau im Schwarzwald, Bronzezeitlicher Kupferbergbau in Derekutuğun, prähistorische Kupfermetallurgie und Kupferbergbau in Akjoujt/MRT, Ausgrabung von Grab 154 in Bat/OMN, vor- und frühgeschichtlicher Silberbergbau auf Ibiza/E, montanarchäologische Surveys in der Türkei (2014 - 2015), bronzezeitlicher Goldbergbau am Ada Tepe/BG, Bergbau in der Sierra de Orihuela bei Alicante/E, neolithischer, mittelalterlicher und neuzeitlicher Bergbau im Harz. Seit 2023 ist er Grabungsleiter am ALSH.
Burgen in Schleswig-Holstein
Montag, den 27. Mai 2024
um 19:30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24837 Schleswig
von Dr. Stefan Magnussen (Kiel)
Schleswig-Holstein ist ein Land der Burgen. Doch wissen wir über die Burgen des Landes bis heute nur ziemlich wenig. Vieles geht auf Annahmen und Meinungen einzelner Männer (und seltener Frauen) zurück, welche die noch sichtbaren Reste ganz im Geiste ihrer Zeit deuteten. Der Vortrag gibt einen Überblick darüber, wie man zu verschiedenen Zeiten die Burgen erforschte, was man in ihnen erkennen wollte - und wie diese Meinungen bis heute nachwirken.
Zum Vortragenden
Stefan Magnussen studierte Geschichte und Politikwissenschaft im Bachelor und Master an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Brock University in St. Catharines, Ontario. Von 2014 bis 2017 war er Doktorand an der Kieler Graduiertenschule “Human Development in Landscapes”, wo er ein Forschungsprojekt zu den Burgen im Herzogtum Schleswig bearbeitete, das 2019 mit der Promotion abgeschlossen wurde. Von 2017 bis 2021 war er Mitarbeiter des Lehrstuhls für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Leipzig, wo er sich im Rahmen des DFG-Projekts "Mediation von Herrschaft an den Grenzen Lateineuropas im Spätmittelalter" mit dem Fallbeispiel Norwegen beschäftigte. Seit Januar 2022 ist er Projektkoordinator des Transfervorhabens "Burgenland Waterkant" an der Abteilung für Regionalgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und seit September desselben Jahres auch Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Burgen- und Herrschaftsforschung im Herzogtum Schleswig, den Königreichen Dänemark, Norwegen und Schottland sowie forschungs- und rezeptionsgeschichtliche Fragestellungen. Seit 2021 produziert und hostet er zudem den landesgeschichtlichen Podcast Küstory - Geschichte(n) von der Waterkant.
Literaturhinweis:Burgen in umstrittenen Landschaften (sidestone.com)
Hirse – ein kleinfrüchtiges Getreide mit spezieller Geschichte und großem Potenzial
Vortrag im Anschluss an die Mitgliederversammlung
um 19:30 Uhr
von Prof. Dr. Wiebke Kirleis (Kiel)
Hirse ist heute ein Hoffnungsträger, weil sie widerstandsfähig gegen Dürre ist. Vor dem Hintergrund von Klimawandel, Wasserknappheit und Dürre bietet Hirse eine umfassende Lösung. Das nährstoffreiche Getreide lässt sich leicht anbauen, gut lagern und einfach zubereiten. Als glutenfreies und leicht verdauliches Getreide liegt es zudem im Trend moderner Ernährung. In diesem Vortrag soll die Kulturpflanzengeschichte der Rispenhirse nachgezeichnet werden. Die Rispenhirse ist ein wahres Multitalent, sowohl aufgrund ihrer vielseitigen und günstigen Eigenschaften für Anbau und Ernährung, als auch in ihrem archäologischen Nachweis. Sie überdauert als verkohltes Getreidekorn und verbackener Brei in alten Abfallgruben, hinterlässt ihre Spuren mit dem Makromolekül Miliacin in alten Speisekrusten und der Matrix von Keramikscherben und hat aufgrund ihres speziellen Photosyntheseweges als C4-Pflanze ein spezifisches Isotopensignal, das sich in Tier- und Menschenknochen einschreibt. Archäobotanische Studien zeigen, dass Rispenhirse bereits in der Bronzezeit ein beliebtes Nahrungsmittel war. In Mitteleuropa tauchte sie bereits vor 3.500 Jahren auf dem Speisezettel auf. Ihr Auftritt erfolgte allerdings erst Jahrtausende, nachdem Bäuer:innen in Europa in der Jungsteinzeit vor ca. 7.500 Jahren begonnen hatten, Emmer und Einkorn anzubauen. Im Gegensatz zu den großfrüchtigen Getreidearten stammt die Rispenhirse aus dem Fernen Osten, dem heutigen China. Mit einem groß angelegten Datierungsprogramm konnten wir die Einwanderungsgeschichte dieses besonderen Getreides nachvollziehen. Über den Kaukasus erreichte sie in der Bronzezeit das Schwarze Meer und den Mittelmeerraum. Hier lässt sie sich erstmals um 1.600 v. Chr. nachweisen. Weiter in Richtung Mittel- und Nordeuropa breitete sie sich bis 1.200 v. Chr. aus und wurde erstaunlich schnell als neues Hauptgetreide akzeptiert. Sie steht stellvertretend für eine Reihe neuer Kulturpflanzen, die den Speisezettel in der Bronzezeit bereicherten. Die Gründe, warum in der Bronzezeit plötzlich so viele neue Geschmacksrichtungen auf den Tisch kamen, sind vielfältig. Große Herausforderungen wie Bevölkerungswachstum, zunehmende Globalisierung, intensiver Ressourcenaustausch, aber auch Starkregen und Dürren durch Vulkanausbrüche und Klimaveränderungen weckten schon in der Bronzezeit die Kreativität und den Innovationsgeist der Menschen, um ein gutes Leben zu sichern.
Zur Vortragenden
Wiebke Kirleis ist Professorin für Umweltarchäologie/Archäobotanik am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel. Seit ihrem Studium der Biologie mit den Schwerpunkten Botanik, Anthropologie und Umweltgeschichte an der Universität Göttingen interessiert sie der menschengemachte Wandel von Landschaften in der Langfristperspektive. Wichtige Stationen ihres Werdegangs waren das Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven, das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege in Wünstorf und der Göttinger Sonderforschungsbereich 552 „STORMA“ zur Stabilität von Regenwaldrandzonen in Indonesien. Derzeit ist sie Co-Sprecherin des Kieler Sonderforschungsbereichs 1266 „TransformationsDimensionen - Mensch-Umwelt Wechselwirkungen in Prähistorischen und Archaischen Gesellschaften“. Sie ist der Archäologie Schleswig-Holsteins u. a. als Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des Steinzeitparks Dithmarschen mit dem Archäologisch-ökologischen Zentrum Albersdorf besonders verbunden.
Wolf und Bär, Hund und Katze. Die Beziehung von Menschen und Raubtieren im Wandel der Zeit
Montag, den 24. Juni 2024
um 19:30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24837 Schleswig
von Dr. Ulrich Schmölcke
Die Gefühle des Menschen gegenüber großen Fleischfressern waren stets ambivalent und reichten von Ehrfurcht und Bewunderung bis hin zu Angst und Abscheu. Mal wurden die Tiere wie Götter verehrt, mal als Abbild des Leibhaftigen gnadenlos gequält und verfolgt.
Am Beispiel der wichtigsten einheimischen Fleischfresser spürt der Vortrag den Hintergründen und Entwicklungslinien der emotionalen Beziehungen des Menschen zu Wolf und Braunbär, Hund und Hauskatze nach und spannt dabei einen weiten zeitlichen und räumlichen Bogen. Dabei wird nach und nach deutlich, dass es nicht Instinkte im tiefsten Innern des Menschen, sondern stets gesellschaftliche, oft religiöse Strömungen waren, die das Bild der großen Fleischfresser in den Augen der Menschen bestimmten.
Zum Vortragenden
Ulrich Schmölcke studierte Biologie an der Christian-Albrechts-Universität Kiel mit dem Hauptfach Zoologie. 1998: Abschluss des Studiums mit einer Diplomarbeit über Wirbeltierreste vom mittelneolithischen Fundplatz Wangels (Ostholstein). 1998–2001 war er wissenschaftlicher Angestellter des Landesamtes für Bodendenkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern. 2002 promovierte er an der Christian-Albrechts-Universität Kiel zur Nahrungsmittelwirtschaft des frühgeschichtlichen Handelsplatzes von Groß Strömkendorf. 2002–2008 war er wissenschaftlicher Angestellter am Zoologischen Institut (ehem. Institut für Haustierkunde) der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Mitarbeit an der Forschergruppe SINCOS (Sinking Coasts) zur Erforschung der Entstehung und Entwicklung der Ostsee. Seit 2009 ist er der Leiter des Arbeitsbereiches „Archäozoologie und Geschichte der Fauna“ am Leibniz Zentrum für Archäologie, Standort Schleswig.
Schleswig-Holstein am Ende der Eiszeit –
Menschen zwischen Ankunft und Aufbruch
Montag, den 30. September 2024
um 19:30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24837 Schleswig
von Dr. Sonja Grimm
Die Auswirkungen des eiszeitlichen Klimawandels wie Gletschermoränen und Schmelzwasserseen wirken in Schleswig-Holstein bis heute nach. Am Ende der Eiszeit waren diese Prozesse noch in vollem Gange: Permafrostböden tauten auf, Sandstürme lagerten flächig Dünen ab und die Vegetation schwankte zwischen gemäßigte Birkenwälder und arktischen Tundrenlandschaften. Forschungen weisen auf eine komplexe Klima- und Umweltentwicklung in Schleswig-Holstein, die auch Auswirkungen auf die Besiedlung dieser Landschaft durch Tiere und Menschen hatte. Neuere Studien an altsteinzeitlichem Material aus Schleswig-Holstein zeigen die hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der mobilen Menschengruppen, die sich durch Jagen und Sammeln ernährten. Zudem wandelten DNS-Analysen unsere Vorstellungen von Mobilität, Siedlungsverhalten und Demographie steinzeitlicher Menschen. Dieser Vortrag bringt die verschiedenen Forschungen zusammen, um den Wandel der Landschaft wie auch das Verhältnis damaliger Menschen zu dieser Landschaft aufzuzeigen. So handelt der Vortrag davon, wie die ersten Menschen nach der letzten Vergletscherung in Schleswig-Holstein ankamen, heimisch wurden und weiter nach Skandinavien aufbrachen.
Zur Vortragenden
Dr. Sonja B. Grimm ist Prähistorikerin und forscht zu verschiedenen Transformationen in der Urgeschichte mit Fokus auf den „Pionieren des Nordens“, die Schleswig-Holstein am Ende der letzten Eiszeit besiedelten. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Leibniz-Zentrums für Archäologie am Standort Schleswig (LEIZA-ZBSA). Ihre Forschungen der letzten 8 Jahre wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen eines Sonderforschungs-bereichs (SFB 1266 „TransformationsDimensionen“) finanziert. Davor war sie als Postdoktorandin in einem vom europäischen Wissenschaftsrat (ERC) finanzierten Projekt in London tätig, dass sie sich auch mit der Wiederbesiedlung Nordeuropas allerdings vorwiegend anhand naturwissenschaftlicher Daten beschäftigte. Studiert hatte Sonja Grimm in Köln und sich 2014 in Mainz zum Übergang vom Jung- zum Spätpaläolithikum in Westdeutschland, Belgien und Nordfrankreich promoviert.
Klima- und Naturschutz
Herausforderungen für die Denkmalpflege
Montag, den 28. Oktober 2024
um 19:30 Uhr
Online-Vortrag
von Tobias Reuter
Moore sind einzigartige Archive mit wertvollen Zeugnissen der Natur- und Kultur-geschichte. Ihre besonderen Erhaltungsbedingungen ermöglichen die Konservierung von organischem Material, das für die Rekonstruktion der Landschafts- und Kultur-geschichte seit der letzten Eiszeit von entscheidender Bedeutung ist.
Entwässerung und Klimawandel bedrohen jedoch diese wertvollen Archive, da sie zur Zersetzung der organischen Substanz und damit zur Zerstörung der darin enthaltenen Zeugnisse der Menschheitsgeschichte führen. Wiedervernässungsmaßnahmen, die derzeit als Maßnahme gegen den Klimawandel verstärkt durchgeführt werden, bieten daher auch Chancen für die archäologische Denkmalpflege, indem sie die Erhaltungsbedingungen wiederherstellen.
Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Eingriffe in den Boden und Veränderungen der Vegetation kulturhistorische Funde gefährden. Daher ist es wichtig, Wiedervernässungsvorhaben aus denkmalpflegerischer Sicht zu prüfen und Planer für diese Belange zu sensibilisieren, um den Schutz des kulturellen Erbes zu gewährleisten. Ziel des Vortrages ist es daher, die Bedeutung von Mooren für die archäologische Denkmalpflege herauszustellen und Lösungsansätze aufzuzeigen, wie der Denkmalschutz bei Moorrenaturierungen angemessen berücksichtigt werden kann.
Zum Vortragenden
Tobias Reuter ist Prähistoriker und forscht zu verschiedenen urgeschichtlichen Themen mit dem Schwerpunkt „Jäger- und Sammlerkulturen in Nordeuropa“. Seit November letzten Jahres arbeitet er am ALSH als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt: Herausforderungen für die archäologische Denkmalpflege in Schleswig-Holstein durch Moorvernässung. Zuletzt hat er im Rahmen des Projektes den Dannewerker See untersucht. Bis vor einem Jahr war er noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie beschäftigt und gleichzeitig Doktorand am Kieler Institut für Ur- und Frühgeschichte. Er hat in Kiel studiert und dort auch seinen Bachelor- und Masterabschluss absolviert.
Schöningen vor
300.000 Jahren.
Ein Blick in die Welt des Homo heidelbergensis
Montag, den 25. November 2024
um 19:30 Uhr
Online-Vortrag
von Dr. Henning Hassmann
Vor genau dreißig Jahren gelang bei Ausgrabungen im niedersächsischen Braunkohle-tagebau Schöningen eine Weltsensation: Unter den bis zu 15 m mächtigen Ablagerungen der Eiszeit konnte das Team des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege in verschiedenen „Stockwerken“ Fundstellen des Urmenschen aufspüren und untersuchen. Feucht und luftdicht eingebettet in ein Schichtpaket, das andernorts durch jüngere Eisvorstöße völlig zerstört wurde, blieb ein Jagdlager perfekt erhalten. Hier hatten steinzeitliche Jäger vor rund 300.000 Jahren am Ufer eines Sees Wildpferde erlegt, gerastet und die ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen der Welt zurückgelassen: Neun sorgfältig gearbeitete hölzerne Speere und mehrere kurze, beidseitig zugespitzte Wurfhölzer zeugen von der erstaunlichen Geschicklichkeit dieser Menschen.
In Schöningen fehlen bisher menschliche Knochenreste – und die sind auch auf diesem Jagdplatz nicht zu erwarten. Dafür ist alles andere da, was andernorts fehlt: Der komplexe Einblick in die Lebenswelt des Homo Heidelbergensis in seiner Landschaft, der Tier- und Pflanzenwelt und dem Klima, tagesscharf rekonstruierbar über die Kieferfragmente der Zuckmückenlarven. Hier fand sich ein unversehrter Jagdplatz der Urmenschen, eingebunden in eine vollständige Stratigrafie. Perfekt erhaltene Knochen mit Bearbeitungsspuren, Stein- und Holzwerkzeuge, Elefanten, Nashörner, Säbelzahnkatzen aber auch Mäuse, Vögel, Fische, bunt schillernde Käferflügel, Eierschalen und Insektenlarven. Dazu die komplette Pflanzenwelt jener Zeit und der Epochen davor und danach. Der Vortrag gewährt einen Einblick in die Lebenswelt unserer frühen Vorfahren und nimmt Sie virtuell mit auf die Ausgrabungen, in die Restaurierungswerkstatt, die Labore und die Ausstellung.
https://forschungsmuseum-schoeningen.de/home
Zum Vortragenden
Dr. Henning Haßmann ist Landesarchäologe von Niedersachsen, Leiter des Forschungsmuseums Schöningen und langjähriges AGSH-Mitglied. Er hat in Münster und Kiel studiert. Promoviert wurde er in Kiel bei Prof. Dr. Müller-Wille über „Die Steinartefakte der befestigten neolithischen Siedlung von Büdelsdorf“. Seine Forschungsschwerpunkte sind Moorarchäologie, Jäger und Sammler, frühe Bauernkulturen, Bronzezeit, Römer und Germanen in Norddeutschland, Forschungsgeschichte des 20. Jh. sowie der Modernen Archäologie.
Rückschau Vorträge 2023
Online-Vortrag: Montag, den 30. Januar 2023 um 19.30 Uhr
Neue Geheimnisse der Pest – Erkenntnisse aus alter DNA
von Prof. Dr. Ben Krause-Kyora (Kiel)
Der Eintritt ist ab ca. 30 min vor Beginn des Vortrags über diesen Link möglich: https://video.openws.de/AGSH
Die Pest, ein Synonym für einer der schlimmsten Pandemien des Mittelalters, wurde durch das Bakterium Yersinia pestis ausgelöst. Die Pandemie begann mit dem sogenannten „Schwarzer Tod“ einer ersten Pandemie welche geschätzte 25 Millionen Todesopfer europaweit forderte. Das Bakterium kommt heute vor allem in Nagetieren vor und wird hauptsächlich durch Flöhe auf den Menschen übertragen. Die mittelalterliche Pest-Pandemie dauerte über 400 Jahre an und verursachte in regelmäßigen Abständen immer wieder historisch überlieferte Ausbrüche in ganz Europa. Wenig ist bekannt darüber wie das Bakterium das Potential entwickeln konnte,diese Pandemie auszulösen oder warum es nach 400 Jahren wieder verschwand. Mittlerweile weiß man zudem, dass der Erreger auch schon mehrere tausend Jahre lang den Menschen infizierte, doch wie er genau entstanden ist, und wann er für die Menschen gefährlich wurde ist bis heute Gegenstand der Forschung. Die alte DNA (aDNA) Forschung beschäftigt sich mit der Analyse von genetischen Informationen von historischen und prähistorischen Menschen aber auch Pathogenen. Diese Technik ermöglicht es einen direkten Einblick in die Veränderungen des Pest Erregers zu erlangen. Der Vortrag soll einen Einblick in die aktuelle aDNA-Forschung zum Pesterregern geben und führt vom ältesten bekannten Pest Fall aus dem heutigen Lettland, über die Veränderungen während der mittelalterlichen Pest bis hin zu den noch heute vorkommenden Pest Bakterien.
Zum Vortragenden: Ben Krause-Kyora, geb. 1980 in Hamburg, ist Professor am Institut für Klinische Molekularbiologie in Kiel. Studium der Ur- und Frühgeschichte und Biochemie in Kiel mit anschließender Promotion. Er hat auf verschiedenen Ausgrabungen gearbeitet, mitunter auch im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein.
Online-Vortrag: Montag, 27.2.2023 um 19.30 Uhr
Die erste Stadt nördlich der Alpen. Neue Ausgrabungen und Forschungen im Umfeld des frühkeltischen Machtzentrums Heuneburg an der oberen Donau
von Prof. Dr. Dirk Krausse
Dirk Krausse stellt in seinem reich mit Animationen und Filmen illustrierten Vortrag die frühkeltische Megasiedlung „Heuneburg“ in der Gemeinde Herbertingen vor, die zu den bedeutendsten prähistorischen Fundstätten Deutschlands zählt. Berühmt sind etwa die nach mediterranem Vorbild errichtete Lehmziegelmauer der Oberstadt oder die reichen Grabfunde in ihrem Umfeld.
Die Ausgrabungen der letzten 15 Jahre haben aber gezeigt, dass es sich bei dem mit der Lehmziegelmauer befestigten „Fürstensitz“ nur um den innersten Kern einer viel größeren Siedlung handelte, die sich im 6. Jahrhundert vor Christus über eine Fläche von ca. 1 km2 erstreckte und mehrere Tausend Einwohner hatte.
Neue Ausgrabungen von Siedlungen und Bestattungsplätzen im Umfeld der Heuneburg zeigen zudem, dass die Heuneburg das Zentrum eines komplexen frühkeltischen Siedlungssystems, mit Verteidigungsanlangen,
Gräberfeldern, Kultplätzen sowie ländlichen Gehöfte und Straßen darstellte. Der spannende Vortrag gibt Einblicke in die Ergebnisse der aktuellen Ausgrabungen und Forschungen.
Zum Vortragenden: Prof. Dr. Dirk Krausse ist ein renommierter Keltenexperte und Landesarchäologe am Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. Er koordiniert die Archäologische Denkmalpflege Baden-Württembergs und lehrt am Institut.
Online-Vortrag: Montag, den 27. März 2023 um 19.30 Uhr
Ausgrabung einer Siedlung in Süderbrarup (Brebel) aus der Zeit des Thorsberger Mooropferplatzes
von Rolf Schulze M.A. (Schleswig)
Im letzten Jahr hat das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein bei einer Voruntersuchung zwischen Brebel und Süderbrarup eine Siedlung aus den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt entdeckt. Nun werden hier im Vorfeld der Erschließung eines großen Gewerbegebietes zahlreiche archäologische Befunde ausgegraben und dokumentiert. Bisher wurden anhand von Pfostenverfärbungen mehrere Grundrisse von Langhäusern aufgedeckt, die auf eine Siedlung der jüngeren Römischen Kaiserzeit (etwa 250–400 n. Chr.) hindeuten. Teile von Haushaltskeramiken und ein Webstuhlgewicht bilden bisher die Hinterlassenschaften der ländlichen Besiedlung. Weitere Hausgrundrisse, die sich bereits in den Schnitten der Voruntersuchung angedeutet haben, sollen in den kommenden Monaten freigelegt werden. Außerdem wurde ein Urnengrab der gleichen Zeitstellung mit der Totenbeigabe einer Fibel (Gewandschließe) entdeckt.
Das Spannende bei diesen Siedlungsbefunden ist, dass sie in die zweite Phase des berühmten Thorsberger Opfermoores zu datieren sind. Möglicherweise lebte hier ein Teil jener Menschen, die das Opfermoor für die Verehrung ihrer Götter nutzten. Ein Highlight der Grabung: Ein Gehöft mit 28,3 m langem Langhaus, Nebengebäude und Zaun mit zaunparalleler Anlage. Zahlreiche Gruben mit Keramikfunden sowie einem Mühlsteinfragment weisen ebenfalls in die jüngere RKZ.
Zum Vortragenden: Rolf Schulze, geboren 1979 in Münster, ist Archäologe beim Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein. Seit dem Studium in der Spätantik- Frühchristlichen Archäologie, Ur- und Frühgeschichte und Klassischen Archäologie in Münster und Hamburg ist er – mit einer Zwischenstation als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg – als Grabungsleiter auf zahlreichen Ausgrabungen in Mecklenburg, Dänemark und Schleswig-Holstein tätig.
Präsenz-Vortrag der AGSH: Montag, 24.4.2023 um 19.30 Uhr
im Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24387 Schleswig
Klimawandel und Pandemie im 6. Jahrhundert aus archäologischer Sicht
von Prof. Dr. Alexandra Pesch
Das 6. Jahrhundert n. Chr. gilt als eine Katastrophenzeit. Vorher, in der Mitte des 1. Jahrtausends, zeichnete sich der Norden Europas durch eine faszinierende materielle Kultur aus: Feinste Goldobjekte zeugten von einer hochstehenden, überregionalen Kultur und Bildkunst sowie von weiträumigen politischen und religiösen Verbindungen der Menschen.
Doch im späten 6. Jahrhundert ist nach einer regelrechten Fundlücke ein drastischer Umbruch sichtbar. Es traten ganz neue Objekte auf, die viele kriegerische Aspekte spiegeln und damit das Ende der friedlichen Epoche anzeigen. Gleichzeitig begann eine kleinteilige Staatenbildung. Internationalen Forschungen zufolge, wurden diese Veränderungen durch eine drastische Klimaverschlechterung ausgelöst, welche ihre Spuren auf der gesamten Nordhalbkugel hinterlassen hat. In deren Folge breitete sich eine Pandemie aus: die Justinianische Pest. Wie die Mehrfachkrise auf die Menschen wirkte und wie diese damit umgingen, lässt sich am archäologischen Material ablesen.
Zur Vortragenden: Frau Prof. Dr. Alexandra Pesch, Jahrgang 1965, ist Wissenschaftlerin am
ZBSA in Schleswig. Ihre Schwerpunkte liegen auf dem ersten Jahrtausend nach Christus und der Wikingerzeit und insbesondere auf der archäologischen Bildforschung. Als außerplanmäßige Professorin lehrt sie in Kiel Ur- und Frühgeschichte sowie Altskandinavistik.
Montag, den 22. Mai 2023 um 19.30 Uhr
Jetzt wird's exotisch: Was wir von archäologischen Funden gebietsfremder oder äußerst seltener Tierarten lernen können
von Dr. Ulrich Schmölcke (ZBSA, Schleswig)
Sie waren die ersten oder letzten ihrer Art im wikingerzeitlichen Ostseeraum und in den Augen der Zeitgenossen wegen ihres auffälligen Aussehens exotisch. Welche Geschichte verbirgt sich hinter den archäologischen Funden dieser Tiere? Welche Bedeutung hatten sie für die Menschen im frühen Mittelalter? An spannenden Beispielen auch aus der Gegenwart zeigt der Referent, wie ehemals weit verbreitete Tiere zu Exoten werden können und wie die Menschen in der Vergangenheit mit Neuankömmlingen umgingen. Dabei ergeben sich ganz ungewohnte Perspektiven auf den Umgang des Menschen mit (anderen) Tieren, die durchaus innerhalb weniger Jahrzehnte vom Alltagsgegenstand zum gehegten Statussymbol werden können - und umgekehrt!
Zum Vortragenden: Dr. Ulrich Schmölcke hat in Kiel Biologie (Hauptfach Zoologie) studiert. Er promovierte zu dem Thema „Nahrungsmittelwirtschaft des frühgeschichtlichen Handelsplatzes Groß Strömkendorf“. Danach arbeitete er als wissenschaftlicher Angestellter am Zoologischen Institut der CAU Kiel. Seit 2014 ist er Koordinator des Themenbereichs Mensch und Umwelt – Umwelt und Mensch des Zentrums für Baltische und Skandinavische Archäologie der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf in Schleswig.
Montag, den 26. Juni 2023 um 19.30 Uhr
Ältestes Grab Norddeutschlands entdeckt!
von Dr. Harald Lübke (ZBSA, Schleswig)
Bei Ausgrabungen des zur Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf gehörenden Zentrums für Baltische und Skandinavische Archäologie in Lüchow, Kreis Hzgt. Lauenburg wurde im vergangenen Herbst die bisher älteste Grabstätte Norddeutschlands entdeckt. Dabei handelt es sich um eine Brandbestattung, die von mittelsteinzeitlichen Jägern, Fischern und Sammlern vor ca. 10.500 Jahren am Rande des Duvenseer Moors angelegt wurde. Das Grab wurde als Block geborgen. Wie es dazu kam und was es neues von der ältesten Bestattung Norddeutschlands gibt, erfahren Sie im Vortrag. Anschließend zeigen wir noch einen Dokumentarfilm über die Ausgrabung.
Zum Vortragenden: Dr. Harald Lübke ist ein ausgesprochener Experte für das Mesolithikum und Forschungstaucher. Seine Dissertation schrieb er über „Die Steinartefakte der steinzeitlichen Fundplätze Bebensee LA 26 und LA 76, Kreis Segeberg. Studien zur Entwicklung der Flinttechnologie im Nordischen Frühneolithikum an binnenländischen Siedlungsplatzinventaren aus dem Landesteil Holstein. Er ist seit 2009 im Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in der Stiftung Landesmuseen Schleswig-Holstein, Schloss Gottorf angestellt.
Im Anschluss an den Vortrag zeigen wir einen 45-minütigen Film von Oskar Friedeberg, der während der Ausgrabungen in Duvensee entstanden ist.
Montag, den 25. September 2023 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24837 Schleswig
Die Ostseeinsel Als (DK) in der älteren Eisenzeit – Eine Untersuchung der Siedlungsstruktur und ihrer Entwicklung von 500 v. Chr. bis 350 n. Chr.
von Solveig Ketelsen, M.A. (ALSH – Außenstelle Bad Segeberg)
Im Rahmen der Masterarbeit der Vortragenden an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Museum Sønderjylland – Arkæologi (Haderslev) erstmals das gesamte verfügbare Fundberichtmaterial des Museums Sønderjylland zu ältereisenzeitlichen Siedlungsfundplätzen der Insel Als (deutsch: Alsen) zusammenfassend und vergleichend bearbeitet.
Dabei ergab sich ein interessantes Bild variabler Siedlungslagen und -größen, ihrer inneren Struktur sowie der äußeren Ausdehnungen und verschiedener Nutzungszeiten. Besonderes Augenmerk lag auf den unterschiedlichen Haupthaustypen von der älteren Vorrömischen Eisenzeit bis zur jüngeren Römischen Kaiserzeit, die eine gewisse Periodenspezifik erkennen lassen. Zudem treten in der behandelten Zeitspanne wechselhafter Siedlungsdynamik erste Dörfer als Siedlungsform auf.
Neben einer erkennbaren kulturellen Verbindung mit Bautraditionen des angrenzenden Festlandes von Sønderjylland treten auch regionale Eigenheiten hervor.
Zur Vortragenden: Solveig Ketelsen, geb. 1995 in Eckernförde, ist seit 2022 Archäologin am Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein. Zuvor studierte sie Vor- und Frühgeschichte, weitere Archäologien und Sprache–Literatur–Kultur in München, Leiden (NL) und Kiel. Ihre Masterarbeit „Die Entwicklung der Siedlungsstruktur auf der Insel Als in der älteren Eisenzeit“, die sie 2021 abschloss, wurde 2022 mit dem Archäologiepreis der AGSH ausgezeichnet.
Montag, den 30. Oktober 2023 um 19.30 Uhr
Königslandschaft an der Schlei –
Danewerk, Haithabu und Schleswig in diachroner Perspektive
von Dr. Thorsten Lemm (ZBSA, Schleswig)
Seit jeher stellte der Süden der jütischen Halbinsel eine besondere Region dar. Zum einen befand sich hier der Kreuzungspunkt zweier wichtiger Verkehrswege, denn im Bereich der Schleswiger Landenge traf die Transitstrecke von der Ost- zur Nordsee entlang der Schlei sowie der Flüsse Treene und Eider auf den Heerweg bzw. Ochsenweg, der Aalborg im Norden mit der Elbe im Süden und somit die Welt Skandinaviens mit Kontinentaleuropa verband. Zum anderen handelte es sich um eine Kontaktzone von vier Kulturräumen – dem dänischen (skandinavischen), friesischen, nordwestslawischen und sächsisch-fränkischen. Diese verkehrsgeografisch äußerst günstige Situation machte sich auch das dänische Königtum zu Nutzen.
Den besten Beleg für das militärische Wirken einer starken Zentralmacht in dieser Region liefert das Danewerk, dessen Wälle in diversen Ausbauphasen zwischen dem 5. und 12. Jh. errichtet, vergrößert, ergänzt, aufgegeben und reaktiviert wurden.
Durch das Danewerk wurde die nur ca. 16 km breite Schleswiger Landenge
abgeriegelt und so das nördlich gelegene Siedlungsgebiet vor Angriffen aus dem
Süden geschützt. Darüber hinaus ermöglichte es die Kontrolle der hier verlaufenden Transitwege. Unter ökonomischen Aspekten ragt der königlich kontrollierte Handelsplatz Haiðabýr/Sliaswich hervor, der im frühen 9. Jh. am inneren Ende der Schlei etabliert wurde, in der Folge einen massiven Aufschwung erfuhr und nach der Zerstörung im Jahre 1066 auf das Nordufer verlegt wurde.
Unter Berücksichtigung von archäologischen und historischen Quellen, von
Runeninschriften sowie von Orts- und Flurnamen möchte der Vortrag die Bedeutung dieser Region für das dänische Königreich und ganz Skandinavien herausstellen und dabei Hinweise auf die Anwesenheit von Königen, ihr machtpolitisches und ökonomisches Wirken, ihr militärisches Gefolge und Königsgüter in dieser Region thematisieren.
Zum Vortragenden: Thorsten Lemm, geboren 1976 in Pinneberg, ist Wissenschaftler am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in Schleswig. Er arbeitet im Forschungsschwerpunkt „Research Cluster Hedeby, Slesvig and beyond“.
Seine Forschungsschwerpunkte sind Kriegsführung im Frühmittelalter, Orts- und Flurnamen in der Archäologie, Rekonstruktion ur- und frühgeschichtlicher Wege, Schlachtfeldarchäologie, Landschaftsarchäologie/Siedlungsarchäologie, das skandinavische Huseby-Phänomen sowie frühmittelalterliche Burgen und Befestigungen.
Montag, den 27. November 2023 um 19.30 Uhr
Der Spinnwirtel von Wittsum, Föhr
von Anina Bolls (Deutschlandstipendiatin)
Im Jahr 2016 brachte eine Ausgrabung in Alt-Witsum, Föhr einen kleinen, aber spannenden Fund hervor: zwei Fragmente eines Spinnwirtels, der mit einer noch nicht gedeuteten Inschrift verziert ist. Gefunden wurden die beiden Bruchstücke in einer Pfostengrube eines Grubenhauses, in dem einst Textilien hergestellt wurden.
Obwohl es sich bei diesem Fund um ein Unikat handelt, sind zahlreiche Spinnwirtel aus Pfostengruben bekannt, darunter auch solche mit Inschriften. Anhand dieser vergleichbaren Objekte aus dem nordeuropäischen Raum wird ein Interpretationsvorschlag zur Funktion und Bedeutung des Spinnwirtels vorgestellt. Diese deuten darauf hin, dass es sich um einen Gegenstand handeln könnte, der im Frühmittelalter mehr als nur eine profane Funktion beim Handspinnen hatte.
Zur Vortragenden: Anina Bolls studierte Anglistik/Nordamerikanistik und Empirische Sprachwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ihr Studium schloss sie mit dem Bachelor ab. Im Wintersemester 2019/20 entschied sie sich für ein weiteres Bachelorstudium in den Fächern Ur- und Frühgeschichte und Skandinavistik, das sie mit der Bachelorarbeit „Der Spinnwirtel von Witsum, Föhr“ bei Prof. Dr. Alexandra Pesch abschloss. Derzeit studiert Frau Bolls im Masterstudiengang Ur- und Frühgeschichte und Skandinavistik (Schwerpunkt Mediävistik). Ihre Interessenschwerpunkte sind die norddeutsche und skandinavische Eisenzeit und das Frühmittelalter sowie die (vor)christliche skandinavische Religionsgeschichte. Sie ist Mitglied der AGSH und erhielt das Deutschlandstipendium von der AGSH im Auftrag der Familienstiftung Manfred Blödorn für das Förderjahr 2022/2023.
Rückschau Vorträge 2022
Online-Vortrag: Montag, den 31. Januar 2022 um 19.30 Uhr
Das Schleswiger Hafenviertel – Zur archäologischen Erforschung eines Fernhandelszentrums zwischen Wikingern und Hanse
von Dr. Felix Rösch (Göttingen)
Schleswig, der mittelalterliche Nachfolger der bekannten Wikingerstadt Haithabu, zählt zu den bedeutendsten Städten des nordeuropäischen Hochmittelalters. Als Bischofssitz war die Stadt mit nicht weniger als sieben Kirchen ausgestattet, Pfalzstandortort des dänischen Königs und Residenz des Herzogs von Schleswig sowie zuvorderst internationales Handelszentrum mit weitreichenden Kontakten. Diese Rolle hatte die Stadt im Zuge des 11. Jahrhunderts von Haithabu übernommen und fungierte daraufhin etwa 150 Jahre lang als zentrale Drehscheibe für den Warenverkehr zwischen Nord- und Ostsee sowie Kontinent und Skandinavien. Bereits 1086 wird Schleswig in der schriftlichen Überlieferung als stark frequentierte Hafenstadt charakterisiert, von der Schiffe zu zahlreichen Küsten Nordeuropas aufbrechen. Im Gegensatz zur historischen Erforschung rückte Schleswig erst ab den frühen 1970er Jahren in den Blickwinkel der Archäologie. Die bislang umfangreichsten Flächengrabungen fanden dabei im historischen Uferbereich statt wobei man auf zehntausende im Boden konservierte Hölzer stieß. Mangels entsprechender Kapazitäten konnten diese Grabungen jedoch erst in jüngster Zeit einer systematischen Analyse unterzogen werden. Diese erfolgte mit modernster Computertechnik, die es ermöglichte, die komplexe Befundlage zu untersuchen und dreidimensional zu visualisieren. Dadurch gelang es, dass Bild eines sich rapide entwickelnden Hafenviertels in der Umbruchszeit zwischen Wikingern und Hanse zu zeichnen. Der Vortrag erläutert die Gründung und Entwicklung dieses Stadtviertels und stellt dabei die einzelnen infrastrukturellen Elemente vor. Diese reichen von systematisch angelegten Parzellen über multifunktionale Dammgrundstücke und Hafenanlagen bis hin zu öffentlichen Marktarealen und komplexen Verkehrswegen. Insbesondere soll im Vortrag auch auf die beteiligten Akteure eingegangen werden, deren Handlungen durch die archäologische Untersuchung sichtbar geworden sind. So treten sowohl königliche Initiativen als auch tägliche Aktivitäten durch Handwerker und insbesondere Kaufleute hervor, von denen letztere ausschlaggebend für die herausragende ökonomische Bedeutung der Stadt waren. Das ganze erfolgt eingebettet in den Hintergrund der maßgeblichen Entwicklungen dieser Epoche, die sich mit Schlagwörtern wie der Herausbildung des professionellen Fernhandels, der Urbanisierung Nordeuropas und der Christianisierung Skandinaviens umreißen lassen.
Zum Vortragenden: Dr. Felix Lennart Rösch wurde 1985 in Braunschweig geboren. Er studierte die Fächer Ur- und Frühgeschichte, Geografie und Bodenkunde, später Europäische Ethnologie/Volkskunde, an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Wie bereits bekannt, fertigte der Preisträger des Archäologiepreises der AGSH 2013 seine Magisterarbeit zu der mittelalterlichen Wüstung von Bad Malente-Grellenkamp an. 2015 schloss er seine Dissertation mit dem Titel „Das Hafenviertel von Schleswig im Hochmittelalter. Entstehung–Entwicklung–Topographie“ ab. Seit 2019 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Georg-August-Universität in Göttingen.
Online-Vortrag: Montag, den 28. Februar 2022
um 19.30 Uhr
Hotspot – Archäologie in Flintbek
von Eric Müller M.A (Bad Segeberg)
Am südlichen Ortsrand von Flintbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde, soll in den
nächsten Jahren ein neues Wohngebiet entstehen. Die Ortslage Flintbek mit seiner Umgebung ist seit den 1970er Jahren durch eine Vielzahl an sehr gut erhaltenen Grabanlagen der Stein- und Bronzezeit bekannt.
Diese Fundstellenkonzentration ist mit einer ur- und frühgeschichtlichen Wegeführung in Verbindung zu bringen, die von Nordost nach Südwest am südlichen Ortsrand der heutigen Ortslage verlief. Direkt am südlichen Zipfel der „Flintbeker Sichel“ liegt das Neubaugebiet, auf dem schon 2020 archäologische
Hauptuntersuchungen stattfanden. Diese werden seit Anfang März 2021 in etwa
400 m Entfernung von der ersten Untersuchungsfläche fortgeführt. Angesichts der im Raum Flintbek bislang bekannten Fundstellen, die bis auf wenige Ausnahmen der Stein- und Bronzezeit angehören, waren die Ergebnisse der Untersuchungen aus dem Jahr 2020 sehr überraschend. Erstmals gelang hier der Nachweis von Siedlungsspuren der Völkerwanderungszeit im Raum Flintbek überhaupt.
Insgesamt konnten vier Gehöfte mit teils sehr gut erhaltenen Langhausgrundrissen, darunter auch ein bislang noch sehr selten nachgewiesener Grundriss eines Hauses vom Typ Korridorhaus, freigelegt werden. Herausragend war die Untersuchung einer gepflasterten Zisternenanlage mit einem Durchmesser von 25 m, welche zu den absoluten Raritäten im Land zählt. Die diesjährigen Ausgrabungen 2021 überraschten nach den Entdeckungen aus dem letzten Jahr. Zu den aufgedeckten Strukturen gehören mehrere Langhausgrundrisse. Eines der Langhäuser gehört mit zwei weiteren gut erhaltenen Häusern zu einem ehemals eingezäunten, mehrphasigen Gehöft mit einer Größe von ca. 6000 m². Die völkerwanderungszeitlichen Fundstellen gehören vermutlich zu einem umfangreichen Siedlungsplatz mit einer größeren zeitlichen Tiefe, der sich, soweit sich derzeit sagen lässt, in lockerer Streuung am gesamten südöstlichen Ortsrand von Flintbek entlangzieht. Aufgrund der neuen Erkenntnisse und der ungewöhnlich guten Erhaltung der Befunde kann im Zusammenhang mit den zuvor bekannten zahlreichen Fundstellen zu Recht von einem „archäologischen Hotspot“ im Bereich und dem Umfeld von Flintbek gesprochen werden.
Zum Vortragenden: Eric Müller M. A. hat Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Geschichtswissenschaften und Philosophie studiert. Anschließend war er als Ausgrabungsleiter und Mitarbeiter an den Landesämtern für Archäologie Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie am Bereich Archäologie der Hansestadt Lübeck und als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Technischen Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern tätig. Seit 2016 ist er Ausgrabungsleiter am Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein.
Online-Vortrag: Montag, den 28. März 2022 um 19.30 Uhr
What actually is a burial’? – Bestattungen als Form der gesellschaftlichen Kommunikation und die Grenzen der archäologischen Aussagekraft
von Dr. Matthias Toplak (Schleswig)
Gräber sind das statische Endergebnis eines ebenso hochkomplexen wie hochdynamischen, ritualisierten und intentionalen Bestattungsvorganges, der in einer nicht mehr nachvollziehbaren Intensität durch soziale, kulturelle und religiös-kultische Faktoren beeinflusst wurde. Dieser Aspekt stellt die Archäologie vor grundlegende Schwierigkeiten. Ein undefinierbar großer Anteil der Handlungen und Rituale, die vermutlichen für die (rituelle) Funktionalität der Bestattung von zentraler Bedeutung waren, lässt sich archäologisch nicht oder nur unsicher fassen. Daneben entgeht der Archäologie ein weiterer für das Verständnis von Bestattungen eklatant wichtiger Aspekt, der erst in jüngster Zeit in den Fokus der Forschung rückt – die Wahrnehmung der Bestattungsriten durch die anwesenden Zuschauer. In der archäologischen Sichtweise werden Gräber – schon notwendigerweise aus methodischen Gründen – oftmals auf objektiv erscheinende, messbare Faktoren wie Form, Maße und Orientierung des Grabes, Anzahl und Lage der Beigaben und Geschlecht und körperlicher Zustand des Bestatteten reduziert. Der Realität von Bestattungen als aktive und dynamische Zeremonien mit rituellen Handlungen, Gesängen und teilweise auch Opfern wird diese nüchterne Reduktion jedoch nicht gerecht.
Zum Vortragenden: Dr. Matthais Toplak hat Skandinavistik, Ur- und Frühgeschichte und Mittlere und Neue Geschichte in Köln und Stockholm studiert. Seine Promotion mit dem Thema „Das wikingerzeitliche Gräberfeld von Kopparsvik auf Gotland. Studien zu neuen Konzepten sozialer Identitäten am Übergang zum christlichen Mittelalter“ schloss er 2016 in Tübingen ab. Danach war er wissenschaftlicher Assistent und lehrte am Institut für Ur- und Frühgeschichte in Tübingen. Er arbeitete von 2017–2021 im Sonderforschungsbereich 1070 RessourcenKulturen, Universität Tübingen, zusammen mit dem Osteoarchäologischen Forschungszentrum (OFL) der Universität Stockholm. 2021 trat er in die Fußstapfen von Frau Drews und hat nun die Leitung des Wikinger Museums Haithabu inne.
Online-Vortrag: Montag, den 25. April 2022 um 19.30 Uhr
Die Gotländischen Bildsteine – Ein Einblick in die aktuelle Forschung zur ihrer Entstehungsgeschichte
von Hannah Strehlau, Schleswig
Die Bildsteine sind eine einzigartige Gruppe von Steindenkmalen, die von der Völkerwanderungszeit bis in die Wikingerzeit auf der schwedischen Ostseeinsel Gotland errichtet wurden (insgesamt etwa 400–1100 n. Chr.). Besonders auffällig sind ihre Verzierungen, die durch flache Ritzungen und anschließende Bemalung auf der Vorderseite angebracht wurden und namengebend für die Steine sind. Die ältesten dieser Bildsteine stammen aus der Völkerwanderungszeit (ca. 400–600 n. Chr.) und unterscheiden sich mit ihrer markanten Axtform sowie dem überwiegend geometrisch-abstrakten Bildprogramm von den späteren Monumenten. Die Entstehungsgeschichte dieser frühen Steine galt seit jeher als Rätsel. Da sie geradezu plötzlich und ohne vorangehende Entwicklungsphase auftreten, liegt es nahe, nach Parallelen außerhalb Gotlands zu suchen. Verblüffende Ähnlichkeiten tauchen dabei zu Steinmonumenten aus den Römischen Provinzen auf. Solche Vergleiche können uns als Archäologinnen und Archäologen Hinweise auf weite internationale Netzwerke geben, die den interkulturellen Austausch und die Hybridität der gotländischen Kultur verdeutlichen.
Zur Vortragenden: Hannah Strehlau, Jahrgang 1991, studierte von 2012 bis 2015 vor- und frühgeschichtliche Archäologie im Bachelor an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Im Anschluss daran schloss sie 2018 ihr Masterstudium an der Universität Uppsala (Schweden) ab, mit einer Arbeit zu Tierbeigaben in vendel- und wikingerzeitlichen Gräbern in Uppland. Während und nach dem Studium hat sie auf verschiedenen Ausgrabungen in Deutschland, Schweden, Serbien und Alaska gearbeitet. Seit 2019 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZBSA in Schleswig angestellt, wo sie an ihrer Dissertation zu den ältesten gotländischen Bildsteinen arbeitet (www.zbsa.eu/en/early-gotlandic-picture-stones). Das Dissertationsvorhaben ist mit dem Ancient Images-Projekt an der Universität Stockholm assoziiert (www.ancientimages.se).
Montag, den 30. Mai 2022 um 19.30 Uhr
im Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24387 Schleswig
Arnulf – Herr der Elbe
von Robert Focken
Der neue Roman von Robert Focken schleudert den Leser in eine weit entfernte Vergangenheit: An der Schwelle zum 9. Jahrhundert gleicht Nordelbien einem brodelnden Völkerkessel. Die Nordsachsen (Sturimarn, Diutmarser, Holsten) sind im Dauerkrieg mit den slawischen Abodriten, beide müssen sich gegen die Dänen aus dem Norden zur Wehr setzen. Mit dem Titelhelden Arnulf stößt schließlich das erste Kontingent fränkischer Panzerreiter von Süden kommend über die Elbe vor. Arnulf allerdings hat mit dem König gebrochen, er stampft zwischen den streitenden Stämmen eine eigene Herrschaft aus dem Boden und errichtet die Hammaburg (Hamburg). Aber der große König hat noch eine Rechnung mit ihm offen: Karl vergisst nichts und vergibt noch weniger... die Geschichte taucht den Leser ein in pralles, mittelalterliches Leben voller Frömmigkeit und Lebensfreude, voller Brutalität und Fatalismus. Zwischen Esesfelth/Itzehoe und Haithabu, zwischen Starigard/Oldenburg und Bardovyk (Lüneburg) sammelt der Kriegsherr Arnulf fieberhaft nach Verbündeten gegen den König – während Arnulfs Frau Erika ihren eigenen Feldzug führt, und zwar gegen die männliche Übergriffigkeit. Sie, die energische Christin, ein echter Tatmensch, strengt schließlich einen großen Schändungsprozess vor einem Thing an. Mithilfe eines Priesters, ausgerechnet, denn eine Frau kann niemanden anklagen. Der Täter aber ist ein Stammesfürst - Arnulf braucht ihn! Beide, Arnulf und Erika werden vor brutale Entscheidungen gestellt, die ihr Leben zu zerreißen drohen.
Zum Autoren: Robert Focken, geboren 1963 in Höxter, wuchs in Holzminden an der Weser auf. Nach dem Abitur wurde er Zeitsoldat, um anschließend eine journalistische Ausbildung bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu absolvieren. Daran schloss sich ein Geschichtsstudium in Bonn an. Seit 1994 lebt Robert Focken in der Nähe von Frankfurt und arbeitet in der Finanzindustrie. Sein erster Roman "Arnulf - Die Axt der Hessen" erschien im Jahr 2015. Robert Focken ist verheiratet und hat drei Kinder.
Montag, den 27. Juni 2022 um 19.30 Uhr
im Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24387 Schleswig
Reste einer völkerwanderungszeitlichen Siedlung in Taarstedt
von Ringo Klooß, Schleswig
Im Vorfeld der geplanten Errichtung eines neuen Wohngebietes in Taarstedt, Kreis Schleswig-Flensburg, führte das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH) eine Voruntersuchung auf dem Gelände durch. Ziel dieser Voruntersuchung war die Klärung, ob bei den kommenden Bautätigkeiten archäologisch relevante Kulturgüter und Strukturen betroffen sind, die hier zu vermuten waren. Im Zuge der
Voruntersuchung zeigte sich anhand zahlreicher Verfärbungen im Boden und diverser Keramikfunde, dass im nordwestlichen Bereich der zu bebauenden Fläche Reste einer völkerwanderungszeitlichen Siedlung erhalten sind, woraufhin eine archäologische Untersuchung des Areals unumgänglich wurde, um diese Befunde nicht undokumentiert der Zerstörung Preis zu geben.
Nach Abtrag des Oberbodens konnten auf der zu untersuchenden Fläche eine Vielzahl an Befunden dokumentiert und eingemessen werden, bei denen es sich zum überwiegenden Teil um Standspuren ehemaliger Pfosten handelt. Anhand dieser Pfostenstandspuren lässt sich in Taarstedt eine Siedlung aus der Völkerwanderungszeit mit mindestens fünf Langhäusern nachweisen. Alle Gebäude waren parallel zueinander ausgerichtet, wobei drei Häuser übereinanderliegen, weshalb der Ausgräber von einer zeitlichen Nähe der Gebäude ausgeht. Die Reste identisch ausgerichteter Gebäude am nordwestlichen Grabungsrand sind sicher als Nachbargehöft der selben Zeit anzusprechen. Rechtwinklig zu den Gebäuden verlaufen sowohl westlich als auch überwiegend östlich der Häuser mehrere Zaunanlagen. Darüber hinaus wurden Siedlungsaktivitäten der Vorrömischen Eisenzeit, des Mittelalters und moderne Flachsrösten nachgewiesen.
Zum Vortragenden: Ringo Klooß hat an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Ur- und Frühgeschichte, Anthropologie und Geologie studiert. Sein besonderes Interesse galt bisher der Jungsteinzeit in Norddeutschland. Nach freiberuflicher Tätigkeit als Archäobotaniker ist er seit 2020 als Grabungsleiter für das Archäologische Landesamt Schleswig- Holstein tätig. Inzwischen komplettiert er außerdem die Abteilung Landesaufnahme.
Montag, den 29. August 2022 um 19.30 Uhr nach der MItgliederversammlung
im Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24387 Schleswig
Neue archäologische Forschungen auf der spätmittelalterlichen Burg Stegen bei Bargfeld (Stormarn)
von Prof. US Dr. Felix Biermann (Stettin und Halle/Saale) und Norman Posselt M.A. (Halle/Saale)
Die Burg Stegen (Gemeinde Bargfeld-Stegen, Kr. Stormarn) bildet heute ein abgelegenes Idyll in den Wiesen der Alten Alster gleich nördlich von Hamburg, war aber in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts Schauplatz dramatischer Ereignisse: Vom Knappen Johann Hummersbüttel prächtig ausgebaut, war der Sitz dieses ehrgeizigen Niederadeligen im Jahre 1347 Ziel einer Belagerung der Holsteiner Grafen und der Stadt Hamburg, die zur Zerstörung und Aufgabe der Wehranlage führte. Neue archäologische Forschungen der Universitäten
Greifswald und Potsdam in Kooperation mit dem ALSH, mit der Gemeinde und mit der Unterstützung vieler ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes konnten wichtige Informationen zur Gestalt und Entwicklung der mit vier Hügeln sehr ausgedehnten Turmhügelburg sowie zum finalen kriegerischen Ereignis gewinnen. Sie werfen damit interessante Schlaglichter auf diesen Brennpunkt der mittelalterlichen schleswig-holsteinischen Landesgeschichte.
Zum Vortragenden: Felix Biermann, geb. 1969 in Herdecke/Ruhr, ist Professor für
Frühmittelalterarchäologie an der Universität Stettin (Szczecin) und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt in Halle an der Saale. Studium der Ur- und Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie in Münster, Marburg, Bamberg und Berlin, Promotion über die slawische Besiedlung der Niederlausitz an der Humboldt-Universität zu Berlin, Habilitation über das ländliche Siedlungswesen der mittelalterlichen Ostsiedlungszeit in Ostmitteleuropa an der Universität Greifswald.
Forschungsschwerpunkte sind u. a. die Archäologie mittelalterlicher Städte, Klöster und Burgen sowie die slawische Frühgeschichte.
Montag, den 26. September 2022
Vortrag: um ca. 19.30 Uhr
im Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24387 Schleswig
Neue Geheimnisse der Pest – Erkenntnisse aus alter DNA
von Prof. Dr. Ben Krause-Kyora (Kiel)
Die Pest, ein Synonym für einer der schlimmsten Pandemien des Mittelalters, wurde durch das Bakterium Yersinia pestis ausgelöst. Die Pandemie begann mit dem sogenannten „Schwarzer Tod“ einer ersten Pandemie welche geschätzte 25 Millionen Todesopfer europaweit forderte. Das Bakterium kommt heute vor allem in Nagetieren vor und wird hauptsächlich durch Flöhe auf den Menschen übertragen. Die mittelalterliche Pest-Pandemie dauerte über 400 Jahre an und verursachte in regelmäßigen Abständen immer wieder historisch überlieferte Ausbrüche in ganz Europa.
Wenig ist bekannt darüber wie das Bakterium das Potential entwickeln konnte diese Pandemie auszulösen oder warum es nach 400 Jahren wieder verschwand. Mittlerweile weiß man zudem, dass der Erreger auch schon mehrere tausend Jahre lang den Menschen infizierte, doch wie er genau entstanden ist, und wann er für die Menschen gefährlich wurde ist bis heute Gegenstand der Forschung.
Die alte DNA (aDNA) Forschung beschäftigt sich mit der Analyse von genetischen Informationen von historischen und prähistorischen Menschen aber auch Pathogenen. Diese Technik ermöglicht es einen direkten Einblick in die Veränderungen des Pest Erregers zu erlangen. Der Vortrag soll einen Einblick in die aktuelle aDNA-Forschung zum Pesterregern geben und führt vom ältesten bekannten Pest Fall aus dem heutigen Lettland, über die Veränderungen während der mittelalterlichen Pest bis hin zu den noch heute vorkommenden Pest Bakterien.
Zum Vortragenden: Ben Krause-Kyora, geb. 1980 in Hamburg, ist Professor am Institut für Klinische Molekularbiologie in Kiel. Studium der Ur- und Frühgeschichte und Biochemie in Kiel mit anschließender Promotion. Er hat auf verschiedenen Ausgrabungen gearbeitet, mitunter auch im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein.
Online-Vortrag:
Montag, den 31. Oktober 2022, um 19.30 Uhr
Ausgrabungen an der Borgsumburg/Föhr
von Dr. Kirsten Hüser
Die Borgsumburg, auch Lembecksburg genannt, erhebt sich mit ihrem gewaltigen Ringwall deutlich über die Marsch- und Geestflächen der Nordfriesischen Insel Föhr. Ausgrabungen der 1950er Jahren belegen, dass die Burg in der Zeit um 800 n. Chr. erbaut und bis etwa 1000 n. Chr. genutzt wurde. Die Burg war im Inneren mit radial entlang des Ringwalls ausgerichteten Häusern aus Grassoden bebaut. Seit dem Sommer 2021 finden im Rahmen eines Forschungsprojektes des Niedersächsischen Institutes für historische Küstenforschung (Wilhelmshaven) neue Untersuchungen im Inneren der Burg unter der Leitung von Dr. Martin Segschneider und Dr. Kirsten Hüser statt. Hierbei soll die Burg durch Ausgrabungen und mittels moderner Methoden weiter erforscht werden, um so neue Kenntnisse zur Erbauung, Funktion und Datierung der Anlage und der Lebensweise ihrer Bewohner zu bekommen. Die ersten Ergebnisse der beiden Ausgrabungskampagnen lassen aufgrund der hervorragenden Erhaltung des Denkmals bereits das große Potenzial der Forschungen in der Borgsumburg erkennen.
Zur Vortragenden: Dr. Kirsten Hüser studierte von 1998 bis 2004 an der Philipps-Universität Marburg Vor- und Frühgeschichte, Geographie und Ethnologie mit anschließender Promotion im Jahr 2009.
Anschließend war sie als Mitarbeiterin verschiedener Projekte und als Ausgrabungsleiterin bei der Ostfriesischen Landschaft in Aurich beschäftigt. Seit 2019 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung (Wilhelmshaven) angestellt und beschäftigt sich dort mit mittelalterlichem Burgenbau.
Online-Vortrag:
Montag, 28.11.2022 um 19.30 Uhr
Neuzeitliche Schiffswracks im Nordfriesischen Wattenmeer
von Dr. Daniel Zwick
Zwischen 2016 und 2022 wurden fünf unbekannte historische Holzwracks im Nordfriesischen Wattenmeer durch Küstenerosion und Stürme frei gespült. Diese Wracks liegen alle in einem exponierten Bereich des Wattenmeers: Hörnum Odde auf Sylt, Japsand bei Hallig Hooge und der Süderoogsand. Hier fanden historisch auch die meisten Schiffbrüche statt. Die rund 20 archäologisch untersuchten Wracks und Wrackteile im Bereich des Nordfriesischen Wattenmeer datieren vom 17. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Diese bilden lediglich die Spitze des Eisberges, denn archivalisch sind etwa 900 Schiffbrüche und Strandungen aus diesem Zeitraum bekannt. In diesem Vortrag werden neben den schon länger bekannten Wracks v. a. die neu-entdeckten Wracks thematisiert. Einige Wracks weisen sehr interessante schiffbauliche Details auf, die v. a. in den Niederlanden und im skandinavischen Raum zu finden sind. Die Identitität der neuen Wracks und das Schicksal der Besatzungen ist noch weitesgehend ungeklärt. Erschwert wird diese Recherche durch die ungewisse schriftliche Quellenlage, denn einige historische Strandungen mündeten im Strandraub und wurden geheim gehalten.
Zum Vortragenden: Dr. Daniel Zwick spezialisierte sich auf die Schiffsarchäologie im Rahmen des Masterstudienganges zur „Maritime Archaeology“ an der University of Southampton. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit in der Rettungsarchäologie, u. a. eine Wrackausgrabung für die Landesarchäologie Bremen und verschiedene Rettungsgrabungen in Großbritannien und Irland, promovierte an der Universität Kiel zum Thema „Maritime Logistics in the Age of the Northern Crusades“ in Zusammenarbeit mit dem Wikingerschiffsmuseum Roskilde und der Süddänischen Universität. Während der Promotionszeit absolvierte er eine Ausbildung zum Forschungstaucher und war in mehreren unterwasserarchäologischen Projekten im In- und Ausland involviert. Seine Projekte führten ihn auch auf das Orlopdeck des im Jahre 1628 gesunkenen und 1961 gehobenen schwedischen Kriegsschiffs VASA, auf dem er Vermessungsarbeiten durchführte. Seit 2016 ist er in verschiedenen Bereichen für das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein tätig, u. a. im BalticRIM Projekt (2017–2020) zur Einbindung des Kulturerbes der Ostsee in die Maritime Raumplanung, sowie in der Drittmittelbeschaffung und Konferenzplanung. Neben diesen Aufgaben untersuchte er auch die neuzeitlichen Wrackfunde aus dem Nordfriesischen Wattenmeer, die zwischen 2016 und 2022 durch Küstenerosion und Stürme freigespült wurden.
Montag, 19.12.2022 um 19.30 Uhr
Sand, Steine, Scherben - eine eisenzeitliche Hofstelle mit erhaltener Laufoberfläche in einem Dünental auf der Insel Amrum
von Dr. Stefanie Klooß, Dr. Ruth Blankenfeldt und Christoph Unglaub M.A.
Der Westteil der nordfriesischen Insel Amrum ist durch einen breiten Dünengürtel gekennzeichnet, unter dem die alte Geestlandschaft mit ihren vorgeschichtlichen Siedlungsplätzen und Grabstätten konserviert ist. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden auf dem frei gewehten Fundplatz Nebel LA 431 nahe der ”Vogelkoje Meeram” freiliegende Strukturen dokumentiert und kleine Sondagegrabungen durchgeführt.
Mit modernen Methoden wird hier ein Gehöft der ausgehenden Vorrömischen Eisenzeit/beginnenden Römischen Kaiserzeit erforscht. In der nahen Umgebung wurden bereits in den 1960er–70er Jahren mehrere Hausplätze frei geweht und durch Hans Hingst dokumentiert.
Der ehemalige Laufhorizont der Siedlung ist durch umfangreich erhaltene Steinpflasterungen gekennzeichnet. Teilweise werden diese durch eine massive Kulturschicht abgedeckt, die gebrannten Lehm, Klei, Holzkohle und zahlreiche Keramikfunde enthält. Neben einem auf etwa 25 m² erhaltenen Hofpflaster, in das eine große Grube und eine Feuerstelle eingelassen sind, konnten mindestens zwei sogenannte Mistrinnen dokumentiert werden, die sorgfältig aus Steinen gesetzt sind und den längs verlaufenden Mittelgang im Stallteil eines Langhauses darstellen. Mehrere ovale, gepflasterte und teilweise mit einer Lehmschicht abgedeckte Herdstellen zeigen den Wohnteil des Gebäudes an.
Intensive Brandspuren in diesem Bereich lassen vermuten, dass diese Hausseite mindestens einmal erneuert werden musste und sich hier eventuell mehrere Siedlungsphasen überlagern. Ein alter Boden mit jungsteinzeitlichen Flintartefakten unter der eisenzeitlichen Siedlungsschicht zeugt von älteren Besiedlungsphasen auf dem Fundplatz.
Zur Vortragenden: Dr. Stefanie Klooß studierte Ur- und Frühgeschichte, Botanik und Geologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie spezialisierte sich auf die Untersuchung von pflanzlichen Resten aus archäologischen Ausgrabungen und forschte in den Themenfeldern Nutzung von Holz- und Wildpflanzenressourcen, Fischfang, Landwirtschaft und Ernährung in prähistorischen Gesellschaften. Seit 2016 ist sie als Gebietsdezernentin des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein zuständig für die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie für die Unterwasserbereiche der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee.
Zur Vortragenden: Ruth Blankenfeldt hat in Münster und Kiel studiert und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf. Durch eine Promotion über den germanischen Opferplatz im Thorsberger Moor liegt ihr Forschungsschwerpunkt vor allem auf den ersten Jahrhunderten nach Christus in Nordeuropa. Als ausgebildete Forschungstaucherin sind zudem Fundplätze unterschiedlicher Zeitstellung im marinen, limnischen und sonstigen Feuchtbodenbereich ein wichtiger Teil ihres archäologischen Interessengebiets.
Zum Vortragenden: Christoph Unglaub studierte in den Jahren 2003 bis 2013 Ur- und Frühgeschichte an der Freien Universität Berlin. In seiner Magisterarbeit beschäftigte er sich mit spätbronzezeitlichen Grabfunden im Land Brandenburg. Nach seinem Studium war er zunächst beim Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege im dortigen Referat „Großvorhaben“ in der Planung und Verwaltung archäologischer Projekte tätig. Seit 2017 widmete er sich verstärkt der Geländearbeit als Grabungsleiter. In dieser Funktion führte er zwischen 2017 und 2020 zahlreiche archäologische Grabungen unterschiedlicher Zeitstellungen in Mecklenburg-Vorpommern durch.
Anfang Mai 2020 wechselte er zum Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein und wurde hier als Leiter des flexiblen Einsatzteams („Team Kleinprojekte“) eingesetzt. Neben der Durchführung von Voruntersuchungen und kleinen Hauptuntersuchungen bekam er auf diese Weise erste Einblicke in die Struktur und die Gegebenheiten beim ALSH. Christoph Unglaub hat die Nachfolge von Herrn Ingo Clausen angetreten und ist folglich für die Kreise Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Segeberg, Stormarn sowie die Stadt Neumünster zuständig.
Rückschau Vorträge 2021
Online-Vortrag: Montag, den 6. Dezember 2021 um 19.30 Uhr
Versunkene Landschaften im Nordfriesischen Watt
von Dr. Ruth Blankenfeldt (Kiel) und Dr. Bente Sven Majchczack
Das nordfriesische Wattenmeer gilt als bedeutender Naturraum und ist heute als Nationalpark und UNESCO-Weltnaturerbe geschützt. Zugleich handelt es sich um das Relikt einer untergegangenen Kulturlandschaft. Umwelteinflüsse, extreme Wetterlagen aber auch Deichbau und künstliche Landgewinnung veränderten die Region in den letzten Jahrtausenden ständig. Konnten manche Flächen nach einer verheerenden Flut zurückgewonnen werden, versanken andere Teile endgültig im Meer. Reste der verlorenen Warften und ihrer landwirtschaftlichen Nutzflächen sind unter der heutigen Oberfläche des Wattenmeeres erhalten.
Ein interdisziplinäres, DFG-teilfinanziertes Forschungsprojekt widmet sich der systematischen Untersuchung ausgewählter Bereiche im nordfriesischen Wattenmeer. Großflächig angewandte nicht-invasive Methoden der Geophysik zusammen mit Auswertungen von Luftbildern und Drohnenfotografie werden mit zielgerichteten geoarchäologischen und archäologischen Untersuchungen kombiniert.
Ein definiertes Arbeitsgebiet befindet sich in der Nähe der heutigen Hallig Südfall, wo der am 16. Januar 1362 versunkene Handelsplatz Rungholt vermutet wird. Erstmals konnte hier der Verlauf eines mittelalterlichen Deiches, Wohnhügel und Entwässerungsgräben rekonstruiert sowie verschiedene Standorte von Gezeitentoren identifiziert werden.
Hallig Hooge und umgebende Wattflächen bilden ein weiteres Untersuchungsareal. Eine Vielzahl von untergegangenen Siedlungsbereichen sowie neue Erkenntnisse zu Umfang und Organisation des mittelalterlichen Salztorfabbaus stehen hier im Fokus der aktuellen Untersuchungen.
Beteiligte Institutionen: Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Naturrisiko-Forschung und Geoarchäologie; Christian-Albrechts-Universität Kiel: Exzellenzcluster ROOTS, Institut für Angewandte Geophysik, Institut für Ur- und Frühgeschichte; ZBSA, Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Museum für Archäologie
Zur Vortragenden: Ruth Blankenfeldt hat in Münster und Kiel studiert und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf. Durch eine Promotion über den germanischen Opferplatz im Thorsberger Moor liegt ihr Forschungsschwerpunkt vor allem auf den ersten Jahrhunderten nach Christus in Nordeuropa. Als ausgebildete Forschungstaucherin sind zudem Fundplätze unterschiedlicher Zeitstellung im marinen, limnischen und sonstigen Feuchtbodenbereich ein wichtiger Teil ihres archäologischen Interessengebiets.
Zum Vortragenden: Bente Majchczack hat in Kiel und Wien studiert, in Rostock promoviert und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am ROOTS Exzellenzcluster der CAU Kiel. Als Archäologe mit einem geophysikalischem Hintergrund führt er ein Forschungsprojekt über die Beziehungen von Mensch und Umwelt im Wattenmeerraum durch. Als gebürtiger Nordfriese hat er seine Forschungsschwerpunkte auf die Besiedlungsgeschichte Nordfrieslands und des Nordseeraumes gelegt, mit besonderem Blick auf die Perioden von der Römischen Kaiserzeit bis zur Wikingerzeit und darüber hinaus, wobei er sich auf ein breites Spektrum an Methoden wie Geophysikalischer Prospektion, Fernerkundung, Detektorarchäologie und Ausgrabungen stützt.
Vortrag: Mittwoch, den 10. November 2021
um 20.00 Uhr in der
A.P. Møller Skolen
Strandweg 1
24864 Schleswig
Was gibt es Neues aus der Landesarchäologie?
von Dr. Ulf Ickerodt, Landesarchäologe Schleswig-Holstein (Schleswig)
Die Arbeit des ALSH ist bunt und vielschichtig. So geht zum Beispiel nach dem Eintrag von Haithabu und Danewerk in die UNESCO-Welterbeliste die archäologische Forschung und denkmalpflegerische Arbeit richtig los. Die Waldemarsmauer muss saniert und konserviert werden. Ein neuer Museumsbau soll im Welterbe-Bereich entstehen. Archäologische Feldprojekte bieten auch in diesem Bereich neue Erkenntnisse. Neben der Arbeit am Welterbe stehen die vielen Felduntersuchungen. In Oeversee werden neue Großsteingräber entdeckt und tragen zur Vollständigkeit unseres Blickes auf die Jungsteinzeit bei. Auch die Baubegleitung am Denghoog ermöglicht einen neuen Blick auf die historische Topografie dieses Denkmals. Auf Amrum werden freigewehte Grundrisse und Pflasterteile genauso wie in Flintbek entdeckt und dokumentiert. Im Rahmen dieses Vortrags soll über die archäologisch-denkmalpflegerische Arbeit des ALSH der letzten zwei Jahre berichtet werden. Weitere, neben den genannten Themen sind u. a. die Unterwasser- und Detektorarchäologie genauso wie die Vorstellung des zentralen Projektes Digitalisierung.
Zum Vortragenden: Ulf Ickerodt ist seit 2018 Landesarchäologe von Schleswig-Holstein. Davor war er stellvertretender Leiter und Abteilungsleiter "Praktische Archäologie" im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein in Schleswig. Er hat in Bonn und Köln studiert und später in Halle/Saale promoviert. Davor hat er neben seinen Arbeitsaufenthalten in Afrika in den unterschiedlichen Landesämtern und in der privatwirtschaftlichen Denkmalpflege gearbeitet.
Online-Vortrag: Montag, den 25. Oktober 2021 um 19.30 Uhr
Neue Details und Beispiele nacheiszeitlicher Umweltveränderungen in Norddeutschland
von Dr. Ulrich Schmölcke (Schleswig)
Als vor 11.600 Jahren mit einem raschen und starken Anstieg der Temperatur die letzte Eiszeit zu Ende ging, veränderte sich die Fauna Mitteleuropas grundlegend. Wie phylogenetische Untersuchungen moderner Tiere zeigen, erschlossen Arten und Populationen aus unterschiedlichen Refugialgebieten kommend das eisfrei werdende Gebiet. Im Genpool heutiger Populationen sind diese Migrationsbewegungen bis heute sichtbar. Auch Arten, die in unserer Zeit kontinentale oder sogar mediterrane Areale haben, wanderten bald darauf in Nordmitteleuropa ein. Verbunden mit hochauflösenden Radiokarbondatierungen können solche Arten als Klimaindikatoren verwendet werden und Aufschlüsse über die Reaktionen einzelner Tierarten auf abrupte Klimaveränderungen geben, wie es sie es auch nach Ende der Eiszeit immer wieder gab. Die Verbreitungsgebiete eng verwandter Tierarten sind mit archäogenetischen Methoden, also der Analyse kleiner Überreste alter DNA, rekonstruierbar, und schließlich erlauben die Verhältnisse bestimmter stabiler Isotope in Tierresten Rückschlüsse auf Nahrungspyramiden und Waldbedeckungsgrad. Kombiniert man alle diese unterschiedlichen Parameter, ist es möglich, ökologische Entwicklungen der Vergangenheit feinskalig nachzuvollziehen und wichtige Schlussfolgerungen für Artenschutzprogramme oder Landschaftsentwickungsziele abzuleiten.
Zum Vortragenden: Ulrich Schmölcke studierte Biologie an der Christian-Albrechts-Universität Kiel mit dem Hauptfach Zoologie. 1998: Abschluss des Studiums mit einer Diplomarbeit über Wirbeltierreste vom mittelneolithischen Fundplatz Wangels (Ostholstein). 1998-2001 war er wissenschaftlicher Angestellter des Landesamtes für Bodendenkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern. 2002 promovierte er an der Christian-Albrechts-Universität Kiel zur Nahrungsmittelwirtschaft des frühgeschichtlichen Handelsplatzes von Groß Strömkendorf. 2002-2008 war er wissenschaftlicher Angestellter am Zoologischen Institut (ehem. Institut für Haustierkunde) der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Mitarbeit an der Forschergruppe SINCOS (Sinking Coasts) zur Erforschung der Entstehung und Entwicklung der Ostsee. Seit 2009 ist er der Leiter des Arbeitsbereiches „Archäozoologie und Geschichte der Fauna“ am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf in Schleswig.
Online-Vortrag: Montag, den 20. September 2021 um 19.30 Uhr
Arbeit unter Druck – Unterwasserarchäologie in Nord- und Ostsee
von Dr. Florian Huber (Kiel)
Denken wir an Unterwasserarchäologie, kommen uns zunächst vermutlich eindrucksvolle Funde aus dem Mittelmeer oder der Karibik in den Sinn. Aber auch Deutschland ist mit Nord- und Ostsee, Hunderten Seen, Tausenden Kilometern Flussläufen, gefluteten Höhlensystemen und Bergwerken sowie Brunnen und Mooren reich an unterschiedlichen Gewässern und somit auch reich an archäologischen Fundstellen. Sie geben uns heute einen einzigartigen Einblick in unsere Vergangenheit. Im Vortrag soll ein Schwerpunkt auf neuzeitlichen Fundstellen des Ersten und Zweiten Weltkriegs in Nord- und Ostsee liegen. Vorgestellt werden die deutschen Schiffswracks des Seegefechts bei Helgoland von 1914 sowie die erst kürzlich gefundenen Enigmen des Zweiten Weltkriegs aus der Geltinger Bucht sowie der Schlei.
Zum Vortragenden: Dr. Florian Huber, 1975 in München geboren, taucht seit frühester Jugend und studierte Archäologie, Anthropologie und Skandinavistik in München und Umeå (Schweden) sowie in Kiel. Bevor er sich als Unterwasserarchäologe und Forschungstaucher selbstständig machte, war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel und leitete dort die Arbeitsgruppe für maritime und limnische Archäologie. Huber ist Autor zahlreicher Fachpublikationen, Zeitschriftenartikel sowie Bücher und steht regelmäßig für TV-Dokumentationen wie Terra X vor der Kamera.
Vortrag: Montag, den 14. Juni 2021 um 19.30 Uhr (online)
“Dark Ages” im Norden? Kulturelle Phänomene zwischen Niedergang und Aufbruch am Übergang vom vierten zum dritten Jahrtausend v. Chr. in Schleswig-Holstein.
von Dr. Jan Piet Brozio
Jan Piet Brozio beschäftigt sich seit Jahren mit dem norddeutschen Neolithikum. Er ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Uni Kiel beschäftigt, an der er auch sein Studium erfolgreich absolvierte.
Am Übergang vom vierten zum dritten Jahrtausend v. Chr. endet die Trichterbecherkultur und zugleich sind tiefgreifende Veränderungen in den neolithischen Gemeinschaften Norddeutschlands und Südskandinaviens zu beobachten. Waren die Jahrhunderte davor von der gemeinschaftlichen Errichtung von Monumenten in Form von Großsteingräbern und Grabenwerken geprägt, erfolgte nun eine zunehmende Auflösung der in größeren Siedlungen zusammengeschlossenen und in Kollektivgräbern bestatteten Trichterbechergemeinschaften in kleinere Gruppen. Neue Kulturerscheinungen wie die Kugelamphorenkultur als auch die Einzelgrabgesellschaften traten auf.
Im Rahmen des Teilprojektes „Neolithische Transformationen in der nordmitteleuropäischen Tiefebene” des Kieler Schwerpunktprogrammes SFB 1266 „TransformationsDimensionen“ erfolgte eine Annäherung an diese Phänomene durch Ausgrabungen und Auswertungen materieller Kultur, deren Ergebnisse im Zentrum dieses Vortrags stehen.
Montag, den 31. Mai 2021 um 19.30 Uhr (online)
Von weisen Männern und trauernden Frauen – Zur Bedeutung von Haar und Bart in der Kunst der Wikingerzeit
von Dr. Sigmund Oehrl
Sigmund Oehrl ist Archäologe und Skandinavist, wurde 2008 in Göttingen promoviert und habilitierte sich 2017 in München. Nach langjähriger Mitarbeit im Runen-Projekt der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und einer kurzzeitigen Anstellung am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in Schleswig ist Oehrl seit 2019 am Archäologischen Institut der Universität Stockholm beschäftigt. Zu Oehrls Forschungsgebieten zählen insbesondere Religion, Kunst und Ikonographie der nordeuropäischen Eisenzeit, Runenforschung und Jagdgeschichte.
In Stockholm leitet er ein vom Schwedischen Wissenschaftsrat gefördertes Projekt über die Bildsteine der Ostseeinsel Gotland. Ziel des Forschungsprojektes ist insbesondere die vollständige 3D-Digitalisierung dieser einmaligen Monumente und ihre digitale Neu-Edition in Form einer frei zugänglichen Online-Datenbank. Weitere Informationen zu diesem Vorhaben sind der Projekt-Homepage sowie zwei kurzen Dokumentarfilmen zu entnehmen:
Im geplanten Vortrag wird Oehrl der Bedeutung von Haar- und Bart in der Kunst der Wikingerzeit nachspüren. Wie in vielen anderen Kulturen des Altertums und des Mittelalters dürften Bart- und Haupthaar auch bei den frühmittelalterlichen Skandinaviern als Sitz der Lebensenergie und besondere Würdezeichen angesehen worden sein, denen geheimnisvolle Kräfte innewohnen. Man denke nur an den israelitischen, bärenstarken Helden Samson, den nach dem Scheren seiner Löwenmähne alle Kräfte verließen, oder an die verbreitete Redewendung „Beim Barte des Propheten“. Von derartigen Vorstellungen scheinen auch Bilddenkmäler der Wikinger-Epoche Zeugnis abzulegen, vor allem eine prominente Gruppe von Figurinen, die sich an den eigenen Bart oder das eigene Haupthaar greifen. Diese Bart- und Haargesten sollen vorgestellt, die relevanten Denkmäler versammelt und ihre Deutungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund weit gestreuter bildlicher und literarischer Parallelen in den Blick genommen werden. Dabei wird auch ein bislang noch wenig gewürdigter Kleinfund aus Haithabu eine Rolle spielen...
Rückschau Vorträge 2020
Aufgrund der Pandemie hat leider nur ein Vortrag stattfinden können.
Montag, den 2. März 2020 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Überleben in der Eiszeit
Aktuelle Forschungsergebnisse zu den Jägern und Sammlern Nordwesteuropas
von Markus Wild, ZBSA Schleswig
Die Archäologie versucht stets anhand archäologischer Hinterlassenschaften sowie deren Untersuchungen menschliches Verhalten zu rekonstruieren. Einen besonders facettenreichen Einblick in unsere Vergangenheit bieten dabei die Fundstellen des späten Jungpaläolithikums aus dem Ahrensburger Tunneltal bei Hamburg. Durch die einzigartig gute Erhaltung von Rentierknochen und -geweih auf diesen Fundstellen ist es möglich, das Leben steinzeitlicher Jäger aus verschiedensten Blickwinkeln zu rekonstruieren. In diesem Vortrag betrachten wir dabei so unterschiedliche Themen wie Traditionen, Schlachtmethoden und die Erziehung von Kindern um schlussendlich verstehen zu können, wie komplex diese frühen Jäger und Sammler schon dachten und wie sie es am Ende der Eiszeit geschafft haben, dem langen und kargen Winter ein ums andere Mal die Stirn zu bieten.
Zum Vortragenden: Markus Wild, 1985 geboren und aufgewachsen in Stuttgart, studierte von 2011–2014 vor- und frühgeschichtliche Archäologie der Universität Mainz. Dort schloss er sein Studium mit einer Masterarbeit zum Thema “Funktionelle Analysen der perforierten Hirschschädel vom frühmesolithischen Fundplatz Bedburg-Königshoven“ ab. Nach verschiedenen Forschungsassistenzen an der Universität Mainz und der Forschungsstelle Monrepos in Neuwied, wechselte er 2015 zur einem Forschungsaufenthalt ans Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA) in Schleswig und promovierte 2019 an den Universitäten Kiel und Paris. Das Thema seiner Arbeit lautet: „Coping with risk through seasonal behavioural strategies. Technological analysis of selected Late Upper Palaeolithic antler assemblages from northern Germany, southern Scandinavia and the Paris Basin”. Seit Ende des Studiums arbeitet er in verschiedenen Forschungsprojekten in Deutschland und Dänemark. Der Schwerpunkt seiner Forschungen liegt im nordmittel- und westeuropäischen Jung- und Spätpaläolithikum mit Fokus auf den Rentierjägern der Hamburger und Ahrensburger Kultur.
Rückschau Vorträge 2019
Montag, den 25. Februar 2019 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Celtic Fields: Stiefkinder der Archäologie nicht nur in Schleswig-Holstein?
von Dr. Volker Arnold (Albersdorf)
Durch immer bessere, teilweise öffentlich einsehbare Laserdaten erschließen sich immer mehr "Celtic Fields" (sensu lato) in Schleswig-Holstein und Dänemark: kleine abgegrenzte und unter günstigen Bedingungen immer noch erkennbare, tendenziell rechteckige Felder, die dicht an dicht liegen und zusammenhängende Systeme bilden. Bekannt sind über 1000 Systeme vor allem in Wäldern, in Dänemark auch in noch bestehenden oder aufgeforsteten Heiden, wovon über 50 mehr als einen Quadratkilometer bedecken – markante Territorien, deren äußere Grenzen einer Dynamik unterlagen und so oft unklar bleiben. Andererseits zeichnen sich mancherorts Systemgrößen ab, die wohl nur von einer einzigen Hofstelle bewirtschaftet wurden. Vor allem auf sandigen Böden scheint mindestens ein Teil der Parzellengrenzen zunächst als schmale Wälle angelegt worden zu sein. Offenbar führte die langjährige Beackerung der Parzellen von sich aus zu einer Aufhöhung und oft auch wachsenden Verbreiterung der Parzellenränder, kombiniert mit einem zunehmend wannenförmigen Querschnitt der Parzellen. Eine Untersuchung eines schwach ausgeprägten Parzellen-Randwalls ergab im Riesewohld in Dithmarschen eine Nutzungsdauer von etwa 600 Jahren; Datierungen in anderen Systemen deuten teilweise eine ähnliche oder noch längere Nutzungsdauer an. Regelhaft finden sich in der durchpflügten Erde der Parzellenränder Reste von Düngerauftrag in Form von stark zerkleinerten Hausabfällen. Die große Typenvielfalt der beobachteten Systeme ist stark von Bodentyp und -relief abhängig und unterscheidet sich demzufolge vor allem in Alt- und Jungmoränenlandschaften. Insgesamt scheint sich eine zeitliche Abfolge von mehr oder weniger quadratischen Parzellen hin zu langrechteckigen Parzellen abzuzeichnen. Während bei Ersteren ein kreuzweises Pflügen mit dem Ard gelegentlich nachzuweisen war, dürften extrem lange Parzellen nur noch in eine Richtung, möglicherweise mit einem Streichbrettpflug, bearbeitet worden sein. Bei manchen dänischen Systemen scheinen Wölbbeete mittelalterlichen Typs unter Berücksichtigung von Celtic-Fields-Parzellengrenzen angelegt worden zu sein, was eine Teilkontinuität über die "dunklen Jahrhunderte" nach der Völkerwanderung andeutet. Völlig unklar bleibt, welche Parzellen wie oft und in welchem Umfang brach fielen bzw. von Vieh beweidet wurden. Auf die Art der Parzellenausformung dürfte jedenfalls die Beackerung einen ungleich größeren Einfluss gehabt haben als eine Beweidung. Ein weiteres großes Aufgabenfeld ist die Datierung der Systeme und ihrer Nutzungsdauer. Nach den Ersten, in Anzahl und Qualität sicher unzureichenden Daten kann nicht ausgeschlossen werden, dass frühe Celtic Fields bereits in der älteren Bronzezeit angelegt wurden, auch wenn in den gleichzeitigen Häusern noch keine Stallteile nachweisbar sind. Sicher dagegen erscheinen sie in der jüngeren Bronzezeit. Mit Beginn der winterlichen Stallhaltung des Viehs, die sich offenbar im Gefolge einer Klimaverschlechterung durchsetzte und in veränderten Hausgrundrissen widerspiegelt, scheint so erstmals ein über Jahrhunderte ortsfester Ackerbau möglich geworden zu sein, der vorherigen Wanderfeldbau ersetzt haben dürfte. Die Stallhaltung führte zur Akkumulation von Streu und Dünger, die dann, zusammen mit Erdmaterial vor allem aus Niederungen zur Erhaltung der Fruchtbarkeit aufgebracht wurden. Das alles ist den agrarischen Umwälzungen am Beginn des Neolithikums durchaus ebenbürtig.
Zum Vortragenden: Volker Arnold, geb. 1947, schloss sein Studium in Köln, Kiel und Tübingen mit einer Promotion über einen spätneolithischen Fundplatz an der Flensburger Außenförde ab und leitete ab 1975 das Museum für Dithmarscher Vorgeschichte in Heide und von 2005 bis 2009 dessen Nachfolgeinstitut in Albersdorf. Seit seinem Ruhestand im Jahre 2010 beschäftige er sich u. a. mit der Natur- und Kulturgeschichte des Riesewohldes und mit der archäologischen Auswertung niederländischer, norddeutscher und dänischer Laserdaten.
Montag, den 25. März 2019 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Tiefe Einblicke in den Untergrund von Hamburg – die neue Burg
von Kay-Peter Suchowa (Hamburg)
Immer wieder kommt es zu Verwechslungen zwischen der Hammaburg und der Neuen Burg in Hamburg. Wie stehen diese Burgen in zeitlichem und geografischem Zusammenhang. Hat die Neue Burg Bezug zur Stadtgründung und wer war verantwortlich für den Bau der größten Burg des 11. Jahrhunderts in Norddeutschland? Können wir aus archäologischen Befunden Hinweise auf die politische und ethnische Situation zu Beginn des 11. Jahrhunderts in Hamburg ziehen? Diese und viele weitere Fragen ließen sich durch archäologische Ausgrabungen in den Jahren 2014, 2015 und 2016, im Bereich der Neuen Burg, beantworten.
Folgen Sie den Archäologen bis zu 5 m Tiefe unter die heutige Oberfläche und entdecken Sie den historischen Untergrund unserer schönen Stadt.
Zum Vortragenden: Kay-Peter Suchowa wurde in Hamburg, wo er auch aufwuchs, geboren. Nach Abitur und Militärzeit studierte er in Hannover Geschichte und Politik, bevor er in Hamburg zur Vor- und Frühgeschichte und Ethnologie wechselte. Bereits während des Studiums arbeitete er In der Bodendenkmalpflege Hamburg auf zahlreichen Ausgrabungen. Nach seinem Abschluss als Magister im Jahr 1999 leitete er zahlreiche Ausgrabungen in Lübeck, u. a. im Bereich des slawischen Königssitzes von Alt-Lübeck. Hinzu kamen Grabungen in mittelalterlichen Konventen und im Bereich der ältesten Wasserkunst Norddeutschlands. Seit 2012 arbeitet er im Bereich der Bodendenkmalpflege des Archäologischen Museums Hamburg. Neben mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Ausgrabungen in der Harburger Schlossstraße und einer damit verbundenen Ausstellung, leitete er verschiedene Ausgrabungen im Bereich der Neuen Burg und in anderen Bereichen der Hamburger Innenstadt. Da ihm die Vermittlung von historischen Erkenntnissen wichtig ist, arbeitete er in verschiedenen Museen als Museumspädagoge und im Bereich der lebendigen Archäologie. Auch auf seinen Ausgrabungen spielen Wissensvermittlung und der Dialog mit Besuchern und interessierten Mitbürgern eine wichtige Rolle. Als Ausgleich zu seiner Ausgrabungstätigkeit wandert Herr Suchowa gerne, beobachtet Tiere und genießt die Ruhe in der Natur.
Montag, den 29. April 2019 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Archäologische Quellen zur Beizjagd bei den Elbslawen
von Dr. Ralf Bleile (Schleswig)
Die Ausübung der Beizjagd war im Mittelalter ein adliges oder sogar königliches Privileg und nur wenigen vorbehalten. Für das Deutsche Reich ist die Ausübung dieser Jagdmethode und ihr hoher Stellenwert im Selbstverständnis der Eliten durch das Buch „De arte venandi cum avibus“ („Von der Kunst mit Falken zu jagen“) des Stauferkaisers Friedrich II. (1194-1250) bekannt. Die Beizjagd ist bis heute eine sehr zeitaufwendige und vor allem kostspielige Jagdmethode. Im Oldenburger Wallmuseum in Oldenburg i.H. steht die lebensgroße Figur eines Slawenfürsten, der einen Beizvogel auf seinem Arm trägt. Gibt es archäologische Quellen, die diese Inszenierung berechtigen und gelten diese nur für die berühmte wagrische Zentralburg Starigard in Oldenburg? Die Spurensuche wird sich mit den Überresten von Greifvögeln und mit den in der Falknerei „Bells“ genannten kleinen Schellen beschäftigen. Ein besonderes Augenmerk gilt außerdem einer silbernen Zierscheibe aus der Slowakei, auf der ein Reiter dargestellt ist, der einen Vogel auf dem ausgestreckten Arm hält. Bei der Prüfung dieses potenziellen Beizjagdmotivs wird der Teppich von Bayeux eine wichtige Rolle spielen.
Zum Vortragenden: Ralf Bleile, geb. 1967, schloss sein Studium in Berlin und Greifswald mit einer Promotion über „Quetzin – Eine spätslawische Burg auf der Kohlinsel im Plauer See. Befunde und Funde zur Problematik slawischer Inselnutzungen in Mecklenburg-Vorpommern“ ab. Danach folgten Tätigkeiten für das Landesamt für Bodendenkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern und die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald als studentischer Grabungshelfer und wissenschaftliche Hilfskraft. In den Jahren 2000–2003 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-Projekt „Gewässernutzung“ am Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte der Universität Greifswald- Ab 2005 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ur-und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität Kiel (Assistenz Prof. Ulrich Müller). 2006 wurde er stellvertretender Direktor am Archäologischen Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schoss Gottorf, seit Januar 2010 ist er ständiger Vertreter des Direktors des Archäologischen Landesmuseums in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf und seit Dezember 2015 durch den Stiftungsrat zum bevollmächtigten Direktor des Archäologischen Landesmuseums bestellt.
In den Jahren 2004–2013 im Auftrag des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein Vertreter des Landes Schleswig-Holstein in der Working Group on Underwater Cultural Heritage of the Baltic Sea, von 2008–2013 Chairman.
Seit 16.3.2017 ist Ralf Bleile als Leiter des Projektes “Umsetzung des Masterplans Schloss Gottorf” zuständig.
Montag, den 27. Mai 2019 um 19.30 Uhr
im Hörsaal des Institutes der Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Johanna-Mestorf-Str. 2-6
24118 Kiel
Die Rolle des Opferkultes im 1. Jahrtausend n. Chr. in Nordeuropa
von Ann-Theres Sinn (Kiel)
Der (Opfer-)Kult drückt eine besondere Beziehung zwischen dem Menschen und dem Übernatürlichen, den Göttern und Wesenheiten aus. Dieser (Opfer-)Kult wird für die Archäologie erst durch für uns sichtbare, d. h. materielle Funde, manifest. Eine große Rolle scheint dabei den sog. Opfer-Mooren zuzukommen, wie Nydam oder Thorsberg, die aufgrund der archäologischen Funde als solche angesprochen werden.
Doch auch bei der Niederlegung von Tieren oder Menschen wird oftmals von einem Opfer gesprochen – das, was nicht zureichend erklärt werden kann, wird schnell als kultisch angesprochen. Erschwerend kommt hinzu, dass bislang in Forschungskreisen kein einheitlicher Begriff von Opfer oder Kult verwendet wird und die Einordnung verschiedener Funde also auf subjektivem Empfinden der untersuchenden Wissenschaftler beruht.
In diesem Vortrag soll der Versuch unternommen werden, sich dem Begriff des Opferkultes kritisch anzunähern und sowohl auf dessen Merkmale, als auch Motivationen der Opfernden selbst hinzuweisen. Dabei wird nicht nur eine theoretische Grundlage erarbeitet, sondern auch auf archäologische (Be-)Funde hingewiesen, die eventuell in einem kontextuellen Zusammenhang zum Opferkult stehen könnten.
Zur Vortragenden: Anna-Theres Sinn studiert in Kiel Philosophie und Ur- und Frühgeschichte, Islamwissenschaften und Pädagogik. Unter anderem studierte sie auch ein Jahr in den Niederlanden zusätzlich Psychologie. Zum jetzigen Zeitpunkt schreibt sie ihre Bachelor-Arbeit bei Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim und Dr. Sven Kalmring über anthropomorphe Spielsteine der Wikingerzeit. Seit Ende 2018 ist sie Trägerin des Deutschlandstipendiums und wird von der Archäologischen Gesellschaft Schleswig-Holstein, dort ist sie seit fast drei Jahren Mitglied, gefördert. Sie ist zertifizierte Sondengängerin am Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein und arbeitet regelmäßig auf Ausgrabungen - so durfte sie nicht nur bei der wikingerzeitlichen Siedlung auf Föhr und dem christlichen Gräberfeld in Haithabu dabei sein, sondern auch im Sommer letzten Jahres eine mongolisch-deutsche Grabungsexpedition in die Mongolei begleiten, um eine frühmittelalterliche Siedlung zu untersuchen.
Montag, den 24. Juni 2019 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Archäologische Einblicke im südlichen Angeln - Von der Mittelsteinzeit bis zu den Wikingern auf 11 km Länge und 8 m Breite
von Dr. Stefanie Klooß (Schleswig)
Anlässlich der Verlegung der neuen 110 KV-Leitung zwischen Ahneby und Süderbrarup durch die Schleswig-Holstein Netz AG fanden im Sommer 2018 mehrere archäologische Ausgrabungen im Bereich der Bautrasse durch das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein statt. Dabei wurde alten Hinweisen nachgegangen und neue Fundplätze entdeckt. Dazu zählen die Knochen eines Jahrtausende alten Auerochsen, verschiedene Urnengräberfelder der Eisenzeit aus den Jahrhunderten nach Christi Geburt und ein Grubenhaus der Wikingerzeit.
Zur Vortragenden: Dr. Stefanie Klooß studierte Ur- und Frühgeschichte, Botanik und Geologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Dort absolvierte sie auch die Ausbildung zum archäologischen Forschungstaucher. Sie arbeitete auf verschiedenen Ausgrabungen in den nördlichen Bundesländern und am Bodensee. Im Rahmen des Forschungsprojektes SINCOS war sie als Forschungstaucherin tätig und promovierte über die steinzeitlichen Holzfunde aus den Unterwassergrabungen an der Ostseeküste. Dann forschte sie an der Universität Kiel über Pflanzenreste aus der Jungsteinzeit in den Themenfeldern Landwirtschaft und Ernährung in prähistorischen Gesellschaften.
Seit 2016 ist sie im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein für die praktische Archäologie in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie für die Bereiche der Nord- und Ostsee zuständig.
Donnerstag, den 22.8.19 um 14:45 Uhr
Grabungsbesichtigung am Fundplatz Strande LA 163
mit Jonas Enzmann M.A.
Treffpunkt: Parkplatz/Campingmobilplatz am Leuchtturm Bülk. Die Teilnehmer werden dort abgeholt und zu Fuß geht es am Leuchtturm Bülk vorbei zur Pforte am Klärwerk. Fußmarsch von ca. 10 min (s. Anlage).
Unser AGSH-Mitglied Jonas Enzmann M.A. wird uns an der Landstation des Unterwasserfundplatzes teils spektakuläre Originalfunde, vor allem aus der diesjährigen Grabungskampagne, vorstellen. Grabungsbilder werden einen Eindruck der Befundsituation und der Arbeit vor Ort geben.
Gefunden wurden bisher u.a. menschliche Überreste, Sprossen von Aalstechern, Geweihäxte, Angelhaken, Fragmente eines Einbaums, Knochen verschiedensterer Meeresfische, See- und Landsäugetiere sowie Reste von Haselnüssen und Muscheln, Flintgeräte wie Beile, Klingen und Pfeilspitzen.
Jonas Enzmann ist uns bestens bekannt. Er hat 2016 für die Masterarbeit "Die Verbreitung der Drehmühlen aus Eifeler Basaltlava im nordwesteuropäischen Barbaricum während der Römischen Kaiserzeit". (Leitung: Prof. Dr. Carnap-Bornheim) den Archäologiepreis der AGSH erhalten.
Der Fundplatz Strande LA 163 befindet sich auf dem Ostseegrund in sechs Metern Tiefe. Bereits die ersten Testgrabungen im Jahr 2012 belegten eine sehr gute Funderhaltung und erbrachten ein umfangreiches Fundinventar, insbesondere organische Funde, zu denen auch menschliche Überreste zählen. Typologische und naturwissenschaftliche Datierungen geben Hinweise darauf, dass der Fundplatz zwischen 5390 und 4750 v. Chr. genutzt wurde. Er datiert demzufolge in den akeramischen Abschnitt der Ertebøllekultur (Jäckelberg/Rosenfelde-Phase), für den bisher an der norddeutschen Ostseeküste nur wenige Nachweise von in-situ erhaltenen Funden existieren. Die Ufersiedlung lag am Rand einer Lagune; dort stellten Jäger, Fischer und Sammler Werkzeuge aus Flint, Knochen, Geweih und Holz her. Vor Ort hatten sie Zugang zu marinen und terrestrischen Nahrungsquellen.
Versunkende Steinzeit in der Ostsee: https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=umHDBrG2_7o
Die praktische Durchführung der unterwasserarchäologischen Arbeiten und die wissenschaftliche Auswertung der Befunde und Funde obliegt dem, seit dem 01.04.2018 im Rahmen einer Doktorandenstelle am NIhK (Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung) tätigen, wissenschaftlichen Mitarbeiter Jonas Enzmann M.A.
http://www.nihk.de/forschung/aktuelle-projekte/strande-erteboelle-kieler-bucht.html
Jonas Enzmann M.A. ist seit 2017 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung tätig, zunächst im Projekt "Der kaiser- bis völkerwanderungszeitliche Ufermarkt Elsfleth-Hogenkamp" und ab 2018 im Projekt „Subsistenzstrategien, Siedlungsstruktur und Kommunikation im Endmesolithikum am Beispiel einer submarinen Mikroregion in der Kieler Bucht“ (DFG-Projekt). Sein Weg zur Archäologie begann 2007 mit seinem Zivildienst bei der archäologischen und paläontologischen Denkmalpflege im Landesamt für Denkmalpflege Hessen in Wiesbaden. Nach einem Studium an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn und einem Wechsel an die Johannes-Gutenberg-Universität zu Mainz erhielt er 2012 den Bachelor of Arts (B.A.) an der philosophischen Fakultät der Johannes-Gutenberg-Universität zu Mainz. Thema: Der Seehandel im Ärmelkanal vom 1. Jh. v. Chr. bis zum 3. Jh. n. Chr. aus Sicht maritimer Fundstellen.
2012-2016 folgte ein Masterstudium Prähistorische und Historische Archäologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Während dieser Zeit ließ er sich zum geprüften Forschungstaucher und daraufhin zum Taucheinsatzleiter für Forschungstaucheinsätze am Forschungstauchzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ausbilden.
2016 erfolgte der Studienabschluss Master of Arts (M.A.) an der philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Thema: Die Verbreitung der Drehmühlen aus Eifeler Basaltlava im nordwesteuropäischen Barbaricum während der Römischen Kaiserzeit.
Montag, den 30. September 2019 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Die Chronistik des Mittelalters: Fakten oder Fakes?
Adam, Helmold und ihre Kollegen kritisch hinterfragt
von Günther Bock (Großhansdorf)
Das Thema des Abends „Die Chronistik des Mittelalters: Fakten oder Fakes?
Adam, Helmold und ihre Kollegen kritisch hinterfragt“ kreist um die für die Geschichtswissenschaft existenzielle Frage der Verlässlichkeit schriftlicher Quellen. Da für das Mittelalter anfangs nur wenige Schriftquellen vorliegen, auf die sich auch weitgehend die Archäologie stützen muss, ergeben sich aufgrund der auf diese Weise erzielten Ergebnisse immer wieder Diskussionen um mögliche Neubewertungen. Diese betrafen jüngst den Baubeginn der Hamburger Neuen Burg – die aufgrund zahlreich gesicherter Dendrodaten erheblich früher entstand, als es der zeitgenössische Chronist Adam behauptet hatte – ebenso wie die Behandlung der slawischen Einwohner im Osten des Landes. Diese, so empfahl es der von christlichen Motiven geleitete Chronist Helmold von Bosau, sollte man mittels „ethnischer Säuberungen“ vertreiben. Tatsächlich ließ sich sein Text als durchweg parteiisch und vielen Passagen als nicht mit den historischen Realitäten vereinbar bewerten. Hinzu kommt der erhebliche Anteil nur abschriftlich oder gar gefälscht überlieferter Urkunden.
Als Kriterien für Untersuchung chronistischer Texte wurden andere Schriftquellen ebenso heran gezogen wie aktuelle Ergebnisse der Archäologie, der Namenskunde, der Siedlungsforschung und weiterer Disziplinen, die ihrerseits strukturellen Analysen und überregionalen Vergleichen unterzogen wurden. Bock geht zudem den Motiven der mittelalterlichen Autoren nach, die sich nicht immer durch übermäßige Wahrheitsliebe auszeichneten.
Zum Vortragenden: Günther Bock wurde 1948 in Hamburg-Wandsbek geboren. Neben langjährigen Tätigkeiten im Grafischen Gewerbe veröffentlichte er seit den 1970er Jahren zahlreiche Artikel zu historischen Themen, verfasste mehrere Monografien, nahm an diversen Projekten und Fachtagungen teil und betreibt eine rege Vortragstätigkeit.
Im Zentrum seiner stets quellen- und methodenorientierten Forschungen standen zunächst Untersuchungen über den Stormarner Raum während des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Dabei erhielt die methodisch betriebene Quellenkritik zunehmende Bedeutung. So gelang ihm beispielsweise die Identifizierung des im 11. Jahrhundert vom Chronisten Adam von Bremen thematisierten sogenannten „Limes Saxoniae“ als Fälschung. Ebenso konnte er dem bis dahin überaus angesehenen Chronisten Helmold von Bosau diverse Falschaussagen zuschreiben. Zu diesen gehört nicht zuletzt die angebliche Gründung Lübecks 1143, das tatsächlich älter ist. Als Konsequenz fühlte Bock sich zu einer grundlegenden Neubewertung dieser Zeiten veranlasst. Diese erschien 2018 mit dem großformatigen Band „Adel, Kirche und Herrschaft – Die Unterelbe als Kontaktraum im europäischen Kontext des 10. bis 13. Jahrhunderts“.
Vortrag: Montag, den 28. Oktober 2019 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Das Jungneolithikum in Schleswig-Holstein von Sebastian Schultrich (Kiel)
Der Preisträger des Archäologie-Preises 2018 gibt uns Einblicke in seine prämierte Arbeit. Dazu gehört eine umfassende Studie zum Jungneolithikum (JN, auch Einzelgrabkultur, ca. 2850 – 2250 v. Chr.) in Schleswig-Holstein. Neben der Darstellung von Funden und Befunden dieser Epoche, liegt ein besonderer Fokus auf Analysen zu den charakteristischen Streitäxten.
Diese eignen sich in hervorragender Weise dazu, einen gesellschaftlichen Wandel zu erkennen, da die morphologische Variationsbreite im Laufe des JN zunimmt. So existieren im späten JN neben sehr elaboriert gestalteten Stücken auch plump wirkende Exemplare. Dies spiegelt vermutlich ein komplexer werdendes Gesellschaftssystem wider und deutet einen Bedeutungswandel der Äxte an. Die Streitäxte werden im Spätneolithikum (SN) durch die Silexdolche abgelöst, die durch ähnliche Variationsunterschiede gekennzeichnet sind. Dies deutet eine Kontinuität in der sozialen Organisation an der Wende zum Spätneolithikum an.
Ein weiterer Fokus wurde auf die Transformation zum JN gelegt, die sich besonders im profanen Bereich als Phase kontinuierlicher Entwicklungen zeigt. Weiterhin wurde ein Unterschied zwischen dem Westen und Osten des Arbeitsgebietes aufgedeckt, der entgegen langläufiger Meinung keine chronologischen Ursachen besitzt. Vielmehr zeigt sich darin eine strukturell unterschiedliche soziale Orientierung der beteiligten Gruppen. Sowohl im JN als auch im SN ist es im Westen gängige Praxis, dem Verstorbenen Statusobjekte (Streitäxte, Silexdolche und frühe Bronzeartefakte) als Grabbeigabe mitzugeben, während diese Objekte im Osten des Landes äußerst selten Eingang in Bestattungen fanden, jedoch als Einzel- und im Falle der Bronzeobjekte auch als Depotfunde regelmäßig anzutreffen sind.
Zur Vortragenden: Sebastian Schultrich studierte Ur- und Frühgeschichte und Geowissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Dort absolvierte er seinen BA und seinen MA. Diese Arbeit mit dem Titel „Das Jungneolithikum in Schleswig-Holstein“ wurde auf dem Tag der Archäologie 2018 von der AGSH mit dem Archäologie-Preis ausgezeichnet. Während seines Studiums arbeitete er auf verschiedenen Ausgrabungen im In- und Ausland und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Ur- und Frühgeschichte. Nach dem Master of Arts begann er im letzten Jahr mit seiner Promotion.
https://www.sidestone.com/books/das-jungneolithikum-in-schleswig-holstein
Montag, den 25. November 2019 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Eine etwas „unarchäologische“ Sichtweise auf den Fundplatz des berühmten Nydambootes
von Karin Göbel (Schleswig)
Das hervorragend erhaltene kaiserzeitliche Ruderschiff aus Eichenholz – das Nydamschiff hat den südjütländischen Fundplatz „Nydam“ weltberühmt gemacht. Es wurde dort im Jahr 1863 von C. Engelhardt (1825-1881) entdeckt und ausgegraben. Im gleichen Jahr wurde kurz nach der Bergung des Nydambootes noch ein weiteres Schiff aus Kiefernholz geborgen, das jedoch nicht erhalten werden konnte. Von den Fundorten der beiden Schiffe sind nur sehr ungenaue Angaben überliefert. In den Jahren von 1989-1999 wurden deshalb im mutmaßlichen Bootsfeld unter der Leitung des dänischen Nationalmuseums auf einer Fläche von 550m² neue Grabungen durchgeführt. Mehr als 13000 neue Funde kamen dabei zum Vorschein, darunter auch viele Bootsteile. Es zeigte sich dabei, dass bei der Bergung der Schiffe im Jahr 1863 sehr eng um diese herumgegraben wurde, so dass der ursprüngliche Fundort der Schiffe anhand der nahezu fundleeren Bereiche und der gestörten Torfschichten im Grabungsfeld sehr genau rekonstruiert werden konnte. Für die Bearbeitung des umfangreichen Datenmaterials wird seit 2006 ein geografisches Informationssystem genutzt, das seitdem ständig mit Daten zu den Altgrabungen und aktuellen Forschungsergebnissen erweitert wird. Besonders die Erfassung der alten Grabungsdokumentationen stellt eine besondere Herausforderung an den Bearbeiter dar und häufig sind detektivische Fähigkeiten gefragt, um doch noch eine räumliche Zuordnung der Informationen zu ermöglichen. Dabei zeigt sich, dass der einzige zur Verfügung stehende Grabungsplan aus Nydam von C. Engelhardt aus dem Jahr 1859 doch sehr viel genauer ist, als ursprünglich gedacht wurde.
Zur Vortragenden: Karin Göbel studierte Geografie, Geologie und Bodenkunde in Kiel. Nach dem Studium arbeitet sie bei verschiedenen Firmen und bildete sich 2006 noch einmal an der Universität in Kiel fort (LeranGIS!) Seit diesem Jahr ist sie auch beim Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie Schloss Gottorf beschäftigt und hat dort die Leitung der Abteilung GIS inne. Karin Göbel ist verheiratet und hat vier Kinder. Sie ist ehrenamtlich sehr aktiv.
Rückschau Vorträge 2018
Montag, den 17. Dezember 2018 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Die Erforschung der Altsteinzeit in Schleswig-Holstein von Dr. Mara-Julia Weber (Schleswig)
Seit seiner Gründung vor zehn Jahren wird am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA) in Schleswig die Altsteinzeit in Schleswig-Holstein und verschiedenen Vergleichsregionen erforscht. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf dem Verhältnis der Jäger-Sammler-Gruppen des ausgehenden Eiszeitalters zu ihrer Umwelt. Durch rasche und teils drastische Klimaveränderungen sowie die Nachwirkungen der weichseleiszeitlichen Gletscherbedeckung Südskandinaviens unterlag auch die Pflanzen- und Tierwelt häufigen Wandlungen, sodass der Mensch sein Verhalten immer wieder an neue Situationen anpassen musste. So zählt neben der Rekonstruktion der Umweltentwicklung auch ihr Verhältnis zur kulturellen Entwicklung zu den Forschungsthemen, die am ZBSA, unter anderem im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 1266 „TransformationsDimensionen“ an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, untersucht werden.
Ein zweiter Forschungsschwerpunkt liegt auf der Herstellung und Nutzung von Artefakten aus Feuerstein und organischen Materialien. Dabei wird einerseits versucht, die technologische Entwicklung während der ausgehenden Altsteinzeit und am Übergang zur Mittelsteinzeit nachzuvollziehen, und andererseits die Situation in Norddeutschland mit denjenigen anderer Regionen zwischen Nordfrankreich und Polen zur selben Zeit verglichen.
In diesem Vortrag wird ein Überblick über die aktuellen Forschungen am ZBSA zu den genannten Themen gegeben. Dabei wird der Bogen vom Ahrensburger Tunneltal zum Pariser Becken, von Isotopenuntersuchungen zu Schussversuchen gespannt.
Zur Vortragenden: Mara-Julia Weber studierte Ur- und Frühgeschichte, Altorientalischen Philologie und Religionswissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und der Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne). Anschließend Doktorandin an der Universität Tübingen mit hauptsächlichem Arbeitsort am Archäologischen Landesmuseum Schleswig, seit September 2008 auch am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA). 2010 erfolgte die Promotion und seitdem Juniorforscherin am ZBSA. 2012 Publikation der Dissertation „From technology to tradition – Re-evaluating the Hamburgian-Magdalenian relationship“. Mara Weber ist assoziiertes Mitglied der UMR (Unité mixte de recherche) 7041 ArScAn (Archéologies et Sciences de l’Antiquité) des CNRS, Mitglied im PCR (Projet collectif de recherche) Paléolithique final et Mésolithique dans le Bassin parisien et ses marges. Habitat, sociétés et environnements (Arbeitsgruppe zum Spätpaläolithikum und Mesolithikum im Pariser Becken) und im Nordic Blade Technology Network. 2008 erhielt sie den Hugo-Obermeier-Förderpreis, dadurch wurden Ausgrabungen in Ahrenshöft LA 58 D (Nordfriesland) ermöglicht. 2013 hatte sie ein Stipendium des DAAD und der Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme und weilte in Frankreich. Seit 2013 ist sie wieder am ZBSA tätig. Sie seit Juni 2018 koordiniert Mara-Julia Weber den Themenbereich Mensch und Artefakt im ZBSA.
Montag, den 26. November 2018 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Das „Nachleben“ der Runen. Rezeption und Missbrauch germanischer Schriftzeichen im 19.–21. Jh.
von Priv. Doz. Dr. habil Sigmund Oehrl (Göttingen)
Runen sind die Schriftzeichen der germanisch sprechenden Gruppen Europas im ersten Jahrtausend n.Chr.. Das deutsche Wort „Rune“, das erst seit dem 17. Jh. existiert, geht auf das germanische Wort für „Geheimnis“ zurück, das noch heute im Verb „raunen“ fortlebt. Die Wikinger glaubten, Göttervater Odin habe die Runen erfunden. Wir kennen viele Runeninschriften, die aus religiösen oder magischen Gründen hergestellt wurden – etwa auf Amuletten oder Grabsteinen. Runen scheinen aber auch in ganz anderen Zusammenhängen verwendet worden zu sein – was soll daran „geheimnisvoll“ sein, wenn auf einem Kamm „Kamm“, auf einem Fußschemel „Schemel“ oder auf einem Schmuckgegenstand der Name der Besitzerin steht? Im Vortrag wird zunächst ein kurzer Überblick über die Runenüberlieferung Europas (insb. Deutschland und Skandinavien) geboten und eine Einführung in die wichtigsten runologischen Forschungsfragen gegeben: Woher stammt die Runenschrift? Wozu dienten Runen, wer hat sie verwendet und welche Informationen überliefern sie?
Mit der Christianisierung und der Etablierung der lateinischen Schriftkultur verschwanden die Runen weitgehend von der Bildfläche, nur in Teilen Skandinaviens blieben sie bis weit in das Mittelalter in Gebrauch. Gelehrte des 17. und 18. Jh. entdeckten die Runen wieder – und machten sie mitunter zum Gegenstand ideologischer und politischer Theorien und Spekulationen, was vor allem um 1900 und in der Nazizeit auflebte und bis heute nachwirkt. Das zentrale Thema des Vortrags sind die verschiedenen Formen neuzeitlicher Rezeption und Instrumentalisierung, insbesondere im „Dritten Reich“ und durch rechtsextreme Gruppierungen, aber auch durch Populärkulturen (Comic-Hefte, Kinofilme, Rockmusik) sowie neoheidnische und esoterische Bewegungen, die anhand von Beispielen erklärt und diskutiert werden sollen. Runen sind durchaus wieder präsent, wobei sie jedoch häufig (aber nicht ausschließlich) Negatives, Aggressives und Neonazistisches evozieren. Nicht-wissenschaftliche, populäre und nicht zuletzt ideologische Vorstellungen prägen jedenfalls das Bild, das heute allgemein von den Runen vorherrscht. Aufklärung tut Not.
Zum Vortragenden: PD Dr. habil. Sigmund Oehrl: geb. 21.11.1979 in Kassel, studierte von 1999 bis 2004 Ur- und Frühgeschichte, Germanistik und Skandinavistik an der Georg-August-Universität Göttingen, die Promotion (über Runensteine) erfolgte 2008. Von 2010 bis 2015 Wiss. Mitarbeiter im Projekt „Runische Schriftlichkeit in den germanischen Sprachen“ der Akademie der Wiss. zu Göttingen. 2013 Gastforscher von Riksantikvarieämbetet, Visby und Statens Historiska Museum, Stockholm. Zwischen 2006 bis 2017 verschiedene Stipendien und andere Förderungen durch die Gerda Henkel Stiftung, die Fritz Thyssen Stiftung und den Deutschen Akademischen Austauschdienst. 2016 wurde Oehrl an der LMU München die venia legendi für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie und für Altnordische Philologie verliehen, seit 2017 ist er Privatdozent. Zuletzt Mitarbeiter am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie Schleswig, gegenwärtig Gastforscher an der Georgia Augusta Göttingen und Lehrbeauftragter der Universität Wien. Oehrls Forschungsschwerpunkte liegen insbesondere im Bereich der interdisziplinären „Germanischen Altertumskunde“. Zu seinen besonderen Interessen zählen Kunst und Ikonografie, Religionsgeschichte, Runologie.
Montag, den 29. Oktober 2018 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Die Ausgrabungen in Haithabu 2017
von Dr. Sven Kalmring (Schleswig)
Die Ausgrabungen auf dem Flachgräberfeld von Haithabu nahmen ihren Ausgangspunkt in der Altgrabung von Helmer Salmo aus dem Jahre 1939. Wegen Ausbruchs des 2. Weltkrieges wurde die Ausgrabung bereits nach 2 Wochen wieder niedergelegt. Am Tage des Überfalls auf Polen, am 1. September, wurden die verbleibenden Befunde mit Dachpappe abgedeckt und die Untersuchung überstürzt abgebrochen. Das Flachgräberfeld wurde vor allem in den Jahren 1908 bis 1912 durch Friedrich Knorr auf einer zusammenhängenden Fläche von 400 m2 studiert. Mit seinen 319 Gräbern, seiner dichten Belegung und fehlenden Grabbeigaben kommt diese Fundsituation einem christlichen Friedhof nach unseren heutigen Vorstellungen sehr nahe. „Echte“ christliche Gräber verfügen generell über keine Beigabenausstattung und sind ost-westlich orientiert, um am Tage des Jüngsten Gerichtes die Rückkehr des Heilands zu erblicken. In der Übergangsphase, die wir in Haithabu fassen, gibt es Gräber mit heidnischer und christlicher Symbolik.
Mit der anschließenden Erweiterung der Grabungsfläche in Richtung Südwesten wurde erwartet, Gräber aus der Spätphase von Haithabu aus dem 10. und 11. Jahrhundert untersuchen zu können. Was dabei heraus gekommen ist, erfahren wir in dem Vortrag!
Zum Vortragenden: Sven Kalmring wurde 1976 in Hamburg geboren. Er studierte Ur- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie und Volkskunde in Kiel und Lund. Im Jahre 2002 fertigte er seine Magisterarbeit Zu den Hafenanlagen von Hedeby. Dendrochronologische und kulturgeschichtliche Untersuchungen zu den Befunden der Ausgrabung 1979/80 an. Eine Vertiefung dieses Themas folgte 2008 in seiner Dissertation Der Hafen von Haithabu. Er arbeitete seit Ende seines Studiums in verschiedenen Projekten im Museum für Archäologie, dem Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in den Landesmuseen Schleswig-Holstein Schloss Gottorf und für die Universität in Stockholm. Zurzeit ist er im ZBSA als fester Mitarbeiter eingestellt. Seit 2015 hat er außerdem die Projektleitung der Untersuchungen "Birka's Black Earth Harbour 2015", zusammen mit Lena Holmquist, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.
Montag, den 24. September 2018 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Martin Luther und die deutsche Sprache von Prof. Dr. Joachim Reichstein
Martin Luther wollte keine neue Kirche gründen. Und dennoch geht die Teilung der Kirche auf ihn zurück. Luther wollte auch keine geeinte deutsche Sprache begründen. Und dennoch hat er einen großen Anteil an unserer einheitlichen deutschen Sprachkultur. Wie groß war Luthers Einfluss auf unsere Sprache? Die Antwort darauf gibt eine Zusammenfassung der sprachgeschichtlichen Forschung der letzten zwei Generationen zu diesem Thema. Luther war eingebunden in die kursächsische Schreibtradition Wittenbergs. Die hohe Autorität und weite Verbreitung von Luthers Bibelübersetzung, geprägt durch seine neue Übersetzungsmaxime und Sprachmächtigkeit, wird als wichtiger Steuerungsfaktor in der jüngeren Sprachgeschichte gewertet.
Hinter Luthers Sprachform der Mitte Deutschlands, seiner guten und sprachmächtigen Übersetzung stand die Autorität des Wortes Gottes – in deutscher Sprache. In der Geschichte des Neuhochdeutschen spielte Luthers Sprache eine wichtige Rolle. Neuhochdeutsch sprechen heute katholische und evangelische Christen gleichermaßen.
Zur Vortragenden: Unser geschätzter und verehrter Ehrenvorsitzender Prof. Dr. Joachim Reichstein gibt uns die Ehre und referiert über ein Thema, dass nicht archäologisch aber gleichermaßen spannend daherkommt.
Herr Prof. Dr. Joachim Reichstein ist allen Mitgliedern der AGSH wohl ein Begriff und bekannt: als Gründer der AGSH, als ehemaliger Leiter des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein, Vorsitzender und aktives Mitglied in zahlreichen Verbänden und Organisationen als Landesarchäologe, als imposanter Redner…. und und und…
Joachim Reichstein wurde 1939 in Lüben/Schlesien geboren. Aufgewachsen ist er in Celle, wo er 1959 das Abitur ablegte. Nach seinem Wehrdienst zog es ihn nach Marburg und nahm dort das Studium der Germanistik (deswegen auch dieser Vortrag) und Geschichte auf. Gleich am ersten Studientag wurde er „Assistent von dem bedeutenden Altgermanisten Prof. Dr. Walter Mitzka. Dieser prägte und förderte seine wissenschaftlichen Interessen. Im Jahre 1961 wechselte Joachim Reichstein an die Universität Kiel, um hier weiter Germanistik und Geschichte zu studieren, wechselte aber dann ab 1962 zur Ur- und Frühgeschichte. Dort lernte er Prof. Dr. Georg Kossack kenne, der ihn für seinen weiteren wissenschaftlichen Lebensweg wesentlich prägen sollte. Seine Dissertation über die kreuzförmigen Fibeln wird heute noch als Standardwerk bezeichnet, gelang ihm doch die Periodisierung der norddeutschen, skandinavischen und englischen Völkerwanderungszeit.
Von 1967–1969 arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent in Saarbrücken, in dieser Zeit führte sein Weg zu einer Ausgrabung in den Libanon. Die Untersuchungen in Alt-Archsum auf Sylt in den folgenden Jahren bildeten den wissenschaftlichen Ansatz, der die weiteren Forschungen und die Arbeit in der Denkmalpflege prägen sollte. Ab 1983 bis 2004 war Joachim Reichstein Leiter des Landesamtes für Vor- und Frühgeschichte von Schleswig-Holstein, was später das noch heute existierende Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein wurde. 1987 wurde ihm der Titel eines Professors verliehen. Die schleswig-holsteinische Archäologie verdankt Joachim Reichstein viel. Sein Engagement endete mit seiner Pensionierung keineswegs und wir sind froh, dass er immer noch so „rührig“ ist.
Montag, den 25. Juni 2018 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Das archäologische Fundmaterial aus dem Eiskeller des Schlosses Agathenburg in Stade
von Katharina Ostrowski (Preisträgerin des Deutschlandstipendiums 2017)
Die Abschlussarbeit beschäftigt sich mit der Auswertung des archäologischen Fundmaterials aus dem Eiskeller des Schlosses Agathenburg bei Stade und der Interpretation im Bezug auf die Alltagskultur auf ländlichen Adelssitzen und Amtssitzen vom 17. bis 19. Jahrhunderts. Das Schloss selbst wurde von dem bedeutenden schwedischen Grafen Hans Christoph von Königsmarck (1605 – 1663) 1652 errichtet. Mitte des 18. Jahrhunderts wird es an das Königreich Hannover verkauft und als Amtssitz genutzt. Ein Jahrhundert später wird das Schloss verpachtet, heute befindet sich dort der Sitz des Stader Geschichts- und Heimatvereins, 1985 wird es an den Landkreis Stade verkauft. Schriftliche Quellen belegen die wechselhafte Geschichte der Bewohner des Schlosses, die qualitativ hochwertige Ausstattung und den wiederholten Verfall.
Bei Sanierungsarbeiten Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre wurden neben einer Gruft in der barocken Gartenanlage und verfüllten Abortanlagen auch der Kellerbereich archäologisch erschlossen. Im Keller befand sich ein bis an den Rand verfüllter und versiegelter Eiskellerschacht aus Backsteinen. Im angrenzenden Bereich eines Weinkellers wurden zudem im Jahr 2000 verschiedene Streufunde aufgelesen. Die Aufarbeitung des reichhaltigen und vielfältigen Fundmaterials beider Befunde bietet die Möglichkeit, die Alltagskultur eines ländlichen Adelssitzes, Amtssitzes und seiner Bewohner nachzuzeichnen und den frühen Konsum von Luxusgütern und Gebrauchswaren nachzuvollziehen. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wie die Menschen dieser Zeit in ihrem spezifischen sozialen Kontext gelebt haben und welche Möglichkeiten die Archäologie zur Beantwortung dieser Frage bietet.
Zur Vortragenden: Geboren am 25.07.1987 in Breslau, seit ca. 1991 wohnhaft in Deutschland, aufgewachsen und zur Schule gegangen in Pforzheim.
Abitur am Hebelgymnasium in Pforzheim (Baden-Württemberg), im Juni 2007
Oktober 2008 – Oktober 2009: Bachelor-Studium, Hauptfach Europäische Ethnologie, Nebenfach Psychologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br.
Oktober 2009 – September 2012: Wechsel des Hauptfachs zu Archäologische Wissenschaften, mit dem Nebenfach Psychologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br.; Abschlussarbeit zum Thema: „Beschläge und Applikationen von der Burg Cucagna. Befundzusammenhänge, Deutungsmöglichkeiten und Aussagewert“
Seit Oktober 2012: eingeschrieben im Masterstudiengang Prähistorische und Historische Archäologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, zusätzlich Erwerb des Zertifikats für Osteuropa-Studien am Zentrum für Osteuropa-Studien der CAU Kiel
Februar – Juni 2014: Auslandsaufenthalt im Rahmen des Erasmus-Programms an der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen, Studienfach Archäologie. 2017 erhielt sie das von der AGSH geförderte Deutshlandstipendium.
Montag, den 28. Mai 2018 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Mit Einbaum und Paddel zum Fischfang
von Dr. Stefanie Klooß (Schleswig)
Der Vortrag befasst sich mit Holzartefakten von endmesolithischen und frühneolithischen Küstensiedlungsplätzen an der südwestlichen Ostseeküste. In diesem Artikel werden die Geräte zum aktiven und passiven Fischfang präsentiert, um die Bedeutung des Fischfangs für die Subsistenz der Menschen während der Phase der Neolithisierung im Verbreitungsgebiet der der Ertebølle-Gruppen und der nördlichen Trichterbecherkultur zu belegen. Die Untersuchung der Aalstecher, Reusen, Fischzäune, Einbäume und Paddel ermöglicht Schlussfolgerungen über deren Herstellungs- und Funktionsweise sowie deren typische Charakteristika. Insbesondere wird die bisher nur in der Ertebøllezeit nachgewiesene Bauweise der Korbreusen aus Spaltstäben des Roten Hartriegels (Cornus sanguinea) und des Schneeballstrauches (Viburnum opulus) vorgestellt. Die Ergebnisse der dendrologischen Analysen zeigen darüber hinaus den damaligen hohen technischen und handwerklichen Standard. Weiterhin können die gezielte Produktion von Holzrohstoffen und damit kleinteilige Eingriffe in die Waldvegetation nachgewiesen werden. Die intensive Nutzung der stationären Fischfanganlagen impliziert das Zusammenwirken einer größeren Gruppe von Menschen und eine stabile soziale Ordnung. Mit dem Beginn des
Frühneolithikums (FN I a) ist noch keine deutliche Veränderung des Siedlungssystems oder der Subsistenzwirtschaft zu erkennen.
Zur Vortragenden: Dr. Stefanie Klooß studierte Ur- und Frühgeschichte, Botanik und Geologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Dort absolvierte sie auch die Ausbildung zum archäologischen Forschungstaucher. Sie spezialisierte sich auf die Untersuchung von pflanzlichen Resten aus archäologischen Ausgrabungen und forscht in den Themenfeldern Nutzung von Holz- und Wildpflanzenressourcen, Fischfang, Landwirtschaft und Ernährung in prähistorischen Gesellschaften.
Montag, den 23. April 2018 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
„Zum Goldenen Anker“ – 500 Jahre Gastlichkeit in Harburg
Von der Preisträgerin des Archäologiepreises 2017
Janna Kordowski M.A.
Gasthäuser gehörten ab dem ausgehenden Mittelalter neben Kirche und Rathaus zu den zentralen öffentlichen Einrichtungen einer Stadt. Als Orte des öffentlichen Konsums und der Geselligkeit sowie als Knotenpunkte für Interaktionen in der Gemeinschaft und mit Reisenden vereinen sie vielfältige Aspekte des sozialen Lebens. Die Beschäftigung mit Gasthäusern kann somit einen weiten Einblick in die sozialen Praktiken der vormodernen Gesellschaft liefern. Trotzdem stehen sie bislang nicht wie andere Orte des öffentlichen Lebens im Fokus der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie. Das Archäologische Museum Hamburg, Abteilung Bodendenkmalpflege, untersuchte 2013 unter der Leitung von Philip Lüth in Harburg in der Schloßstraße das historisch für das 19. Jh. nachgewiesene Gasthaus „Zum Goldenen Anker“. Die baulichen Reste von fünf aufeinanderfolgenden Häusern reichen sogar bis in das 15. Jh. zurück. Während der Ausgrabung konnten über 5000 Funde geborgenen werden, die einen kleinen Einblick in das Leben und Arbeiten der verschiedenen Besitzer geben. Die Preisträgerin des Archäologiepreises 2017, Janna Kordowski, verarbeitete diese dokumentierten Ergebnisse in ihrer Masterarbeit, die sie bereits kurz am Tag der Archäologie im November 2017 in kurzem Umfang vorgestellt hat. Im Rahmen unseres Abendvortrages hören wir nun die etwas ausführlichere Version.
Zur Vortragenden: Janna Kordowski ist am 10. August 1989 in Neumünster geboren und dort auch aufgewachsen. Nach dem Abitur zog sie zum Studium nach Kiel und studierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel im Bachelorstudium Klassische Archäologie und Ur- und Frühgeschichte, im Masterstudium widmete sie sich voll und ganz der Ur- und Frühgeschichte.
Dienstag, den 10. April 2018 um 18:30 Uhr
zusammen mit dem Förderverein des Archäologischen Landesmuseums e.V. im Vortragssaal auf Schloss Gottorf in Schleswig
Expedition Wikinger
von Barbara Lipsky-Post und Stefan Lipsky
Fast vier Jahre und etwa 30.000 Kilometer sind die Journalisten Barbara Post und Stefan Lipsky durch Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen auf den Spuren der Nordmänner – und Frauen unterwegs gewesen. Sie wollten die Magie der Orte jener Zeit, die in Büchern beschrieben werden, selbst spüren.
Aber sie wollten auch nach nur selten erwähnten Plätzen suchen, an denen Geschichte in der Wikingerzeit geschrieben wurde: So findet man Spuren eines 500 m langen, gegrabenen Kanals auf der dänischen Insel Samsø. Die Reste einer 760 m langen Eichenholzbrücke im jütländischen Ravning oder einen alten, gepflasterten Straßenzug im seeländischen Risby.
Dabei stießen die Journalisten auf ein spannendes Phänomen: Die Welt der Wikinger ist auch heute kein abgeschlossenes Kapitel. Neue Funde und Erkenntnisse fügen dem Bild immer neue Facetten hinzu und verändern es. Man denke an die enorme Mobilität der Menschen jener Zeit. In der Wikingerzeit fand bereits etwas statt, was wir heute Globalisierung nennen.
Ziel dieser Expedition war es auch, in Wort und Bild zu dokumentieren, um einen Reiseführer zu den Stätten der Wikinger zu veröffentlichen. Unter dem Titel „Faszination Wikinger“ ist dieses Buch im Theiss-Verlag erschienen. Die wichtigsten zweihundert Plätze, zwischen Hamburg und dem Polarkreis, an denen die Spuren der Wikinger heute noch zu sehen sind, werden in diesem Buch dargestellt.
Montag, den 26. Februar 2018 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Landschaftsentwicklung in Haithabu: unerwartete Funde in der wikingerzeitlichen Metropole
von Svetlana Khamnueva (Kiel)
Ehemalige Siedlungen sind ein wichtiges Archiv zur Rekonstruktion von Mensch-Umwelt-Interaktionen. Haithabu war in der Wikingerzeit ein bedeutendes internationales Handelszentrum und eine der ersten urbanen Siedlungen in Nordeuropa und Skandinavien. Obwohl durch langjährige archäologische Untersuchungen viele Informationen über die Entwicklung Haithabus sowie die Lebensweise seiner Einwohner gewonnen wurden, steht unser Wissen über die Landschaftsentwicklung Haithabus erst am Anfang. Insbesondere der Bereich am Haithabu-Bach im westlichen Teil der Siedlung wurde bisher gar nicht untersucht. Die durch die Arbeitsgruppe Ökosystemforschung und Geoarchäologie an der CAU Kiel durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass das Ausmaß der Landschaftsveränderungen durch den Menschen wesentlich größer und vielschichtiger ist, als bisher angenommen wurde.
Mithilfe von Bohrprofilen und statistischen Analysemethoden konnten heterogene und komplexe Kulturschichten und Siedlungsablagerungen zum ersten Mal klassifiziert werden. Darauf basierend wurde die Stratigrafie der Sedimente am Haithabu-Bach ermittelt. Ein mächtiges mit Sedimenten gefülltes Tal aus der Wikingerzeit wurde direkt am Haithabu-Bach entdeckt. Die Forschungsergebnisse weisen auf eine anthropogene Entstehung des Tals hin. Detaillierte geochemische und mikromorphologische Analysen sowie Radiokarbondatierungen ermöglichten die Rekonstruktion der Phasen vor der Entstehung der Schlucht bis hin zur Verfüllung des Tals seit dem frühen Mittelalter bis heute. Die Existenz dieses breiten und tiefen Tals im zentralen Bereich der Siedlung muss eine bedeutende Rolle bei der räumlichen und funktionellen Aufteilung Haithabus gespielt haben. Mit welchem Zweck solch eine Struktur im zentralen Bereich der Siedlung geschaffen wurde, lässt sich aktuell noch nicht zweifelsfrei klären. Mehrere Hypothesen werden derzeit diskutiert: von der Optimierung des Süßwassermanagements hin zur Materialentnahme für verschiedene Siedlungsaktivitäten. In den späteren Siedlungsphasen scheint sich die Nutzung des Tals jedoch hin zur Entsorgung von Abfällen verschiedenster Art verändert zu haben.
Es ist die Fortsetzung des Vortrages vom 5.2.2015, als Prof. Dr. Hans-Rudolf Bork, Svetlana Khamnueva und Jann Wendt (Kiel) dieses gemeinsame Projekt begonnen haben. Der damalige Vortrag hieß: Neue Untersuchungen zu den Oberflächenformen von Haithabu. Oder: Wie aus einer tiefen Schlucht das Tal des Haithabu-Baches wurde. Ebenfalls zu lesen in den ANSH 2015. Die Ergebnisse werden in den ANSH 2018 zu lesen sein.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung tragen zu einem besseren Verständnis der Landnutzung und der anthropogenen Landschaftsveränderungen in Haithabu bei und sind relevant für geoarchäologische Untersuchungen in anderen proto-urbanen wikingerzeitlichen Siedlungen.
Zur Vortragenden: Svetlana Khamnueva und ist in Russland aufgewachsen und zur Schule gegangen. Sie begann 2004 mit dem Studium an der Fakultät für Bodenkunde in Moskau. 2009 kam sie mit einem Stipendium des DAAD (Deutschen Akademischen Austauschdienstes) nach Kiel und absolvierte dort ihr Masterstudium „Environmental Management“ an der CAU in Kiel. Sie promovierte danach am Institut für Ökosystemforschung (ebenfalls Kiel) und beendete ihre Dissertation im letzten Jahr.
Montag, den 29. Januar 2018 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Viren in der alten DNA oder auch die Suche nach der Nadel im Heuhaufen
von Julian Susat (Kiel)
Julian Susat beschäftigt sich mit der Detektion von Viren/viralen Nukleinsäuren in alten DNA (aDNA) Proben. Schon in seiner Masterarbeit versuchte er virale Sequenzen auf bioinformatischer Ebene in den Proben nachzuweisen. Dabei hat sich gezeigt, dass nur eine sehr sorgfältige manuelle Kontrolle einen positiven Nachweis erbringen kann. Eine weitere Hürde in diesem Forschungsgebiet ist das nicht alle Viren in Knochen- oder Zahnproben vorhanden sind. Um das Virus in diesen Proben nachweisen zu können, muss es in der Lage sein über den Blutkreislauf in die Knochen oder die Zähne gelangen. Bisher ist das Feld der sogenannten Paleovirologie/aDNA Virologie auch sehr übersichtlich, da bisher nur eine Handvoll positiver Ergebnisse beschrieben wurde.
Zum Vortragenden: Julian Susat studierte in Hannover Pfanzenbiotechnologie und schloss dort sein Studium mit einem Bachelor ab. Danach wechselte er für sein Masterstudium der Biologie an die Universität nach Kiel. Dort promoviert er seit 2016.
Rückschau Vorträge 2017
Montag, den 27. November 2017 um 19.30 Uhr
im Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Johanna-Mestorf-Hörsaal
Johanna-Mestorf-Straße 2-6, 24118 Kiel
Tauchgang ins Totenreich – Archäologie unter dem Meeresspiegel
Dr. Florian Huber (Kiel)
Rund drei Millionen Schiffswracks sowie unzählige versunkene Städte und Siedlungen liegen in unseren Weltmeeren. Grund genug für den Unterwasserarchäologen Florian Huber, unserem kulturellen Erbe seit knapp 20 Jahren auf den Grund zu gehen.
Folgen Sie dem Forschungstaucher zur Mars, dem größten schwedischen Kriegsschiff des 16. Jahrhunderts, das 1564 in einer dramatischen Schlacht in der Ostsee gesunken ist und heute mit modernster Technik in 80 Meter Wassertiefe untersucht wird.
In den Unterwasserhöhlen Mexikos entdecken Huber und sein Team einen Maya-Friedhof, in den Blue Holes der Bahamas prähistorische Skelette ausgestorbener Krokodile. Vor Helgoland erkunden die Wissenschaftler ein deutsches U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg, das unter mysteriösen Umständen untergegangen ist, und in Mikronesien im Pazifik die japanische Geisterflotte von 1944.
Zum Vortragenden: Dr. Florian Huber, 1975 in München geboren, taucht seit frühester Jugend und studierte Archäologie, Anthropologie und Skandinavistik in München und Umeå (Schweden) sowie in Kiel. Bevor er sich als Unterwasserarchäologe und Forschungstaucher selbstständig machte, war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel und leitete dort die Arbeitsgruppe für maritime und limnische Archäologie. Huber ist Autor zahlreicher Fachpublikationen, Zeitschriftenartikel sowie Bücher und steht regelmäßig für TV-Dokumentationen wie Terra X vor der Kamera. Weitere Infos: www.florian-huber.info
Mittwoch, den 25. Oktober 2017 um 19.30 Uhr
im Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Johanna-Mestorf-Hörsaal
Johanna-Mestorf-Straße 2-6, 24118 Kiel
Auf den Spuren bronzezeitlicher Gemeinschaften in Nord- und Mitteleuropa
Dr. Jutta Kneisel (Kiel)
In unserer heutigen Welt der Globalisierung ändert sich auch die archäologische Sichtweise. Nicht länger stehen regionale Phänomene und deren Verständnis im Mittelpunkt der Forschung, sondern länderübergreifende Verbindungen quer durch Europa und bis hin nach Asien. Gerade mit dem Beginn der Bronzezeit und des neuen Rohstoffes Kupfer erfassen wir eine neue Ära der großräumigen Verbindungen. Der Vortrag beleuchtet zwei unterschiedliche Fundplätze: Bruszczewo, eine frühbronzezeitliche Siedlung der Aunjetitzer Kultur, die über 300 Jahre kontinuierlich besiedelt ist und dann plötzlich aufgegeben wird. Bredenbek und Mang de Bargen sind Bestattungsplätze, die etwas jünger sind, aber eine lange Kontinuität bis in die Spätbronzezeit aufweisen. Das spannende an diesen Fallbeispielen ist, dass Bredenbek beginnt, wenn Bruszczewo aufhört. Anhand dieser Fundplätze lässt sich daher ein bronzezeitliches Drama beschreiben, dass den heutigen politischen Ereignissen in Europa in nichts nachsteht.
Zur Vortragenden: Jutta Kneisel (geb. 17.09.1968) studierte Ur- und Frühgeschichte in Berlin und Bergen/Norwegen) und absolvierte ihren Abschluss am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Freien Universität Berlin.
2000–2002: Mitarbeiterin der Gesellschaft für Archäologische Denkmalpflege e.V. mit verschiedenen Grabungsprojekten in Brandenburg
2002–2003: wiss. Assistentin am Institut für prähistorische Archäologie Berlin mit Aufgaben im Bereich der Forschung (Feudvar) und Lehre bei Prof. B. Hänsel
2004–2008: angestellt als wiss. Mitarbeiterin im DFG-Projekt Bruszczewo - eine frühbronzezeitliche Feuchtbodensiedlungen in Großpolen bei Prof. J. Müller (Otto-Friedrich-Universität Bamberg, ab 2005 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
2007: Abschluss der Promotion „Anthropomorphe Gefäße der Bronze- und Eisenzeit in Nord- und Mitteleuropa“ an der Freien Universität Berlin bei Prof. B. Teržan und Prof. B. Hänsel
2008–2009: wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kiel mit Schwerpunkt Lehre
2009–2012: mit einer eigenen Stelle im Forschungsprojekt „Kultureller Wandel am Übergang von der FBZ zur MBZ im nordöstlichen Mitteleuropa“ der DFG betraut
2013: wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kiel (Scientific Data Manager and Fieldwork Coordinator)
Weitere Infos: http://www.sfb1266.uni-kiel.de/de/teilprojekte/cluster-d/d3-die-bronzezeit-in-nordmitteleuropa-skalen-der-transformation-1
Montag, den 25. September 2017, um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Der hat x und y vertauscht!
Vermessung in der Archäologie
Anja Buhlke (Berlin)
Mit welcher Zielsetzung wird die Vermessung in der Archäologie eingesetzt?
Welche Bedingungen, Möglichkeiten sowie technischen und beruflichen Entwicklungen und Ergebnisse gab es von den Anfängen bis heute in diesem Gebiet?
Hauptsächlich diesen Fragen wird sich der Vortrag widmen, der auch Probleme und Schwierigkeiten zum Inhalt hat. Durch das Thema werden gleichzeitig das Berufsbild des Grabungstechnikers bzw. die Einsatzmöglichkeiten für Vermesser/ Vermessungsingenieure in der Archäologie aufgezeigt. Wir werden also in diesem Vortrag eine etwas andere, aber notwendige Seite der Archäologie zu Gesicht bekommen! Ohne richtige Vermessung geht es eben nicht ….
Zur Vortragenden: Anja Buhlke, in Berlin geboren, ist Kartografin und Ausgrabungstechnikerin. Sie studierte erst Kartografie an der Technischen Fachhochschule Berlin und fertigte als Abschlussarbeit den „Danewerk-Atlas“ an. Danach studierte sie an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Grabungstechnik. Sie arbeitete nach ihren Studien an verschiedenen archäologischen Projekten in verschiedenen Ländern.
Montag, den 26. Juni 2017 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Variationen in Kraweel: Zwei ungewöhnliche frühneuzeitliche Schiffwracks aus dem nordfriesischen Wattenmeer
Dr. Daniel Zwick (Schleswig)
Was hat die westaustralische Wallabi-Inselgruppe und die Sylter Inselspitze von Hörnum Odde gemeinsam? Nicht viel könnte man denken, doch haben sich an beiden Orten Küstenhavarien von Schiffen zugetragen, die einer ganz speziellen Bauweise angehörten und die nur auf ganz bestimmten Seerouten operierten. Bei dem einem handelt es sich um das berühmte Wrack des niederländischen Ostindienfahrers BATAVIA, welche 1629 vor Australiens Küste auf ein Riff gelaufen ist, und bei dem Hörnumer Befund um ein Wrack eines noch unbekannten Schiffes. Dieses wurde im Oktober 2016 entdeckt und ist infolge eines gewaltigen Küstenerosionsprozesses zutage gekommen. Das um/nach 1690 datierte Wrack weist eine doppelte niederländische Schalenkonstruktion auf und ist das jüngste bekannte Wrack dieser Bauweise. Vergleichsfunde sind aus den Niederlanden und vor allem auf den Fahrtrouten der Niederländischen Ostindienkompanie nachgewiesen, welche grundsätzlich Schiffe mit einer doppelten Eichenbeplankung einsetzte. Aufgrund dieses Umstandes wurde diese bauliche Eigenheit oftmals mit der Kompanie assoziiert, aber trifft dies auch auf das Wrack von Hörnum zu?
Im Februar 2017 wurde ein weiteres Wrackteil von Hallig-Bewohnern bei einer Wattwanderung beim Japsand vor Hallig Hooge entdeckt. Dieses datiert um/nach 1617 und ist ebenfalls als ungewöhnlicher Befund zu bezeichnen. Es handelt sich um ein Bordwand-Fragment aus einem sogenannten Halbkraweel, bei dem das Unterwasserschiff geklinkert und die Seiten kraweel beplankt sind. Zu dieser Zeit stellten Schiffe mit kraweeler Rumpfbeplankung die Spitze der Schiffbaukunst dar. Dagegen galten Klinkerkonstruktionen als altmodisch und wurden mit der ländlich-bäuerlichen Küstenschifffahrt assoziiert. Das Aufkommen von Halbkraweelen, welche im Grunde getarnte Klinkerkonstruktionen waren, wird oft als Versuch verstanden, diese Schiffe aufzuwerten. Diese ungewöhnliche hybride Bauform ist archäologisch erstmals bei einem um 1577 datierenden Wrackfund in Nordschweden nachgewiesen worden. Auch in den nachfolgenden Jahrhunderten tauchen Halbkraweele in archäologischen und schriftlichen Quellen immer wieder in Schweden auf. Außerhalb der Ostsee und in Schleswig-Holstein war diese Bauform bislang unbekannt.
Beide Wracks wurden vom Vortragenden und anderen Mitarbeitern des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein untersucht und werfen neue Forschungsfragen auf, durch welche ein bislang unbekanntes Kapitel der Seefahrtsgeschichte an Schleswig-Holsteins Küsten aufgeschlagen wird.
Zum Vortragenden: Dr. Daniel Zwick spezialisierte sich auf mittelalterliche und frühneuzeitliche Schiffsbefunde im Rahmen des Masterstudienganges zur „Maritime Archaeology“ an der University of Southampton. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit in der Rettungsarchäologie, u.a. im Rahmen einer Wrackausgrabung für die Landesarchäologie Bremen und verschiedenen Rettungsgrabungen von Headland Archaeology Ireland und dem Museum of London Archaeology Service, begann er seine Promotion in deutsch-dänischer Zusammenarbeit an der Universität Kiel zum Thema „Maritime Logistics in the Age of the Northern Crusades“, die er 2016 abschloss. Seitdem arbeitet er für das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein.
Montag, den 29. Mai 2017 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Wolf und Bär, Hund und Katze – Menschen und Raubtiere im Wandel der Zeit
Dr. Ulrich Schmölcke (Schleswig)
Dass Menschen zu großen Fleischfressern eine ambivalente Beziehung haben, wird uns in diesen Jahren der Rückkehr des Wolfes bei einem Blick in die Zeitung deutlich vor Augen geführt. Diese Ambivalenz zwischen Faszination und Respekt, zwischen Kult- oder Leitbild und „dem bösen Wolf“ ist immer noch präsent. Der Vortrag zeichnet den historischen und prähistorischen Weg der menschlichen Wahrnehmung des Wolfs, aber auch von Bären und anderen Arten nach und kommt dabei zu durchaus überraschenden Ergebnissen, denn das Ansehen dieser Arten war im Laufe der Zeit einem steten Wandel unterworfen, abhängig vom politischen und religiös-spirituellen Umfeld. Ein weiterer Teil des Vortrags beleuchtet die Geschichte von Hund und Katze und erklärt den aktuellen Wissensstand auf diesem Gebiet. Auch hier wird deutlich, dass die Wertschätzung dieser Haustiere von Kultur und Epoche zwischen Hochachtung und Verteufelung schwanken kann.
Zum Vortragenden: Dr. Ulrich Schmölcke hat in Kiel Biologie (Hauptfach Zoologie) studiert. Er promovierte zu dem Thema „Nahrungsmittelwirtschaft des frühgeschichtlichen Handelsplatzes Groß Strömkendorf“. Danach arbeitete er als wissenschaftlicher Angestellter am Zoologischen Institut der CAU Kiel. Seit 2014 ist er Koordinator des Themenbereichs Mensch und Umwelt – Umwelt und Mensch des Zentrums für Baltische und Skandinavische Archäologie der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf in Schleswig.
Montag, den 24. April 2017 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Die Verbreitung der Drehmühlen aus Eifeler Basaltlava im nordwesteuropäischen Barbaricum während der Römischen Kaiserzeit
von dem Preisträger des Archäologie-Preises 2016
Jonas Enzmann M.A.
Im Gegensatz zu vielen anderen Objekten, die im Barbaricum als „Römischer Import“ klassifiziert werden, ist die Herkunft der Handdrehmühlen aus Basaltlava mit den Steinbrüchen bei Mayen relativ sicher zu bestimmen. Bereits Anfang des 20. Jh. erkannten Forscher, dass es sich bei den kleinen Gesteinsfragmenten, die sich immer wieder in germanischen Siedlungen fanden, höchstwahrscheinlich um Importstücke aus dem Römischen Reich handelte. Petrografische Analysen in den letzten Jahren bestätigen diese Theorie. Ziel der Arbeit war es, die gängige These von einem Transport über den Rhein und die Nordsee, die anhand einer auf das nördliche Niedersachsen beschränkten Kartierung entwickelt worden war, zu überprüfen.
Zu diesem Zweck wurden 1541 publizierte Basaltlavafragmente aus Dänemark, Nordwestdeutschland und den Niederlanden aus germanischem Kontext ausgewertet. Die Funde verteilen sich auf 206 Fundstellen. Im Zeitraum von Christi Geburt bis 400 n. Chr. konzentrieren sich die Funde auf das zentrale Ruhrgebiet, die westfälische Hellwegzone, die Flüsse Werre, Weser und Hunte sowie die größeren Flussmündungen an der Nordseeküste. Die Verbreitung wurde mittels sog. Transportzonen interpretiert. Diese Zonen orientieren sich an natur- und kulturräumlichen Grenzen und erlauben es, die Austauschprozesse vor dem Hintergrund von regional unterschiedlichen ökonomischen und gesellschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Daraus resultierte das Ergebnis, dass neben einer Austauschroute über den Rhein und die Nordsee eine binnenländische Route entlang der genannten Konzentrationen von Bedeutung war. Dabei lassen sich regional sehr unterschiedliche Austausch- und Transportarten fassen. Des Weiteren zeigt sich, dass die Mischung aus großräumigem Modell und kleinräumiger Analyse, wie es das Transportzonenkonzept ermöglicht, ein wichtiges Werkzeug zur Erforschung des innergermanischen Austausches sein könnte.
Zum Vortragenden: Unser Preisträger Jonas Enzmann studierte Archäologie in Mainz und absolvierte dort seinen Bachelor. In Kiel wurde er zum Forschungstaucher ausgebildet und schrieb dort seine preiswürdige Masterarbeit.
Montag, den 20. März 2017 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Birka im Mälarsee - von Häfen, Hallen und Herigar
von Dr. Sven Kalmring, Schleswig
Im Jahre 2015/16 führte das Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in Kooperation mit der Universität Stockholm Ausgrabungen im „Schwarze Erde“-Hafen von Birka durch. Diese orientierten sich an der Ausgrabung der Jahre 1970/71 durch Björn Ambrosiani, bei der im ehemaligen Uferbereich eine „Steinkiste“ zu einer hölzernen einer Landebrücke freigelegt wurde. Über die eigentliche hölzerne Brückenstruktur, die auf das Wasser hinausführte, war wenig bekannt. Auch der Datierungsvorschlag in das frühe 10. Jahrhundert rief vor dem Hintergrund der Hafenentwicklung in Haithabu Fragen auf. Für das Verständnis des Urbanisierungsprozesses in Nordeuropa ist jedoch eine nähere Kenntnis der Hafeninstallationen unabdinglich, da erst diese die Teilnahme am Fernhandel zu See ermöglichten und somit die ökonomischen Voraussetzungen des frühen urbanen Lebens sicherten. Da in Birka über diese eine Anlage hinaus kaum andere Hafenanlagen erforscht sind, wurde an dieser Stelle mit einer Nachgrabung neu angesetzt.
Im Herbst 2016 geriet ein weiteres Hafenbecken in den Fokus der Untersuchungen. Die Bucht von Korshamn, dem sogenannten „Kreuzhafen“, befindet sich außerhalb des Halbkreiswalles von Birka am äußersten Rande des Gräberfeldes Hemlanden. An dieser Stelle ist seit langem die Existenz einer singulären Hausplattform ähnlich der Anlagen in Gamla Uppsala bekannt, die jedoch nie archäologisch untersucht wurde. Nun konnten unweit dieser weitere Hausterrassen identifiziert werden, die zusammen mit dem Hausplattform auf einen größeren Herrensitz deuten. Georadaruntersuchungen weisen auf eine bedeutende merowingerzeitliche Halle und ein wikingerzeitliches Langhaus hin. An das Langhaus schließt sich im rechten Winkel eine Steinstruktur an, die sich über Vergleiche mit den Befunden aus Lejre und Tissø nun als Kultbezirk identifizieren lassen. Die weitere Erforschung dieses Herrschersitzes verspricht einen entscheidenden Beitrag für das Verständnis zur Entstehung von Birka, dessen königliche Verwaltung, die christliche Missionierung und letztendlich den Beginn der Europäisierung Skandinaviens.
Montag, den 27. Februar 2017 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Neuer Welterbeantrag Haithabu und Danewerk
von Matthias Maluck
Schleswig-Holstein startet einen neuen Versuch, dass das archäologische Denkmal-Ensemble Haithabu und Danewerk als UNESCO-Welterbestätte anerkannt wird. Den entsprechenden Antrag hat Kulturministerin Anke Spoorendonk am 13. Dezember dem Kabinett vorgestellt. 2015 war ein gemeinsamer Antrag mehrerer Länder zur Eintragung des Wikingererbes in Nordeuropa vom UNESCO-Welterbekomitee zur grundsätzlichen Überarbeitung an die Antragsstaaten zurückverwiesen worden. Eine Überarbeitung des transnationalen Antrags war aus Sicht der Partnerstaaten nicht möglich, weshalb man sich entschloss, das gemeinsame Vorhaben nicht weiterzuführen. "Wir haben uns aber entschlossen, Haithabu und Danewerk als Einzelantrag zu nominieren. Nach den UNESCO-Regularien gibt es für uns die Möglichkeit, über die deutsche Tentativliste 2017 einen zusätzlichen Einzelantrag in Form einer Nominierung als Kulturlandschaft einzureichen", erläuterte Spoorendonk. "Dazu musste der neue Antrag auf dieses besondere Ensemble konzentriert und die Denkmale als Kulturlandschaft und nicht als archäologische Stätte nominiert werden. Eine Eintragung als UNESCO-Kulturlandschaft wäre ein großer Erfolg für die Region und für Schleswig-Holstein insgesamt."
Die Neu-Nominierung "Die archäologische Grenzlandschaft von Haithabu und dem Danewerk" konzentriert sich auf die besondere Bedeutung durch die Grenzlage an der Schleswiger Landenge, die gleichzeitig in der Wikingerzeit auch zum Handelsknoten zwischen Nord- und Ostsee wurde. Das Verteidigungssystem Danewerk und das Handelszentrum Haithabu verkörperten dabei einerseits die Austragung von Konflikten und die Kommunikation von Macht im Südskandinavien der Wikingerzeit vom 8.-11. Jahrhundert.
Die so entstandene Grenzlandschaft zeigte auch den Austausch und den Handel zwischen dänischen, fränkischen, sächsischen und slawischen Gebieten und Eliten. Danewerk und Haithabu bekamen eine wissenschaftliche Schlüsselstellung für die Interpretation und das Verständnis des historischen Wandels in der Wikingerzeit. Die Vielfalt und die Qualität der archäologischen Zeugnisse von Haithabu und Danewerk weisen auf die einzigartige Rolle dieser Landschaft als Mitte eines Grenzraums zwischen dem christlichen Kontinent und den skandinavischen Gesellschaften hin, was sie zum einzigartigen Zeugnis der Geschichte Nordeuropas erhebt. Der jetzige Antrag unterscheidet sich vom vorherigen, transnationalen Antrag vor allem in seiner Reduktion auf Haithabu und Danewerk, die vorher nur eine Komponente unter mehreren waren. Zudem ist er nun ein rein nationales Vorhaben statt eines transnationalen seriellen Projektes.
Der Vortrag stellt den Neuansatz der Welterbenominierung vor und erläutert die Unterschiede zum vorherigen Antrag. Zudem werden Fragen des praktischen Denkmalpflegemanagements im Rahmen des Antrags besprochen. Die Diskussion mit dem Publikum ist dabei ausdrücklich erwünscht.
Zum Vortragenden: Matthias Maluck studierte Archäologie in Heidelberg, Galway/Irland und Kiel und arbeitet seit 2005 am Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein. Er führte u. A. internationale Projekte etwa zur Erhaltung von Kulturlandschaft im Wattenmeergebiet zusammen mit Dänemark und den Niederlanden durch. Seit 2008 ist er für den UNESCO Welterbeantrag für Danewerk und Haithabu und die Pflege beider Stätten verantwortlich. Im letzten Jahr übernahm der die Leitung der Abteilung für Planung und internationale Projekte.
Info: http://www.schloss-gottorf.de/haithabu/auf-dem-weg-zum-weltkulturerbe
Montag, den 30. Januar 2017 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Masterplan Schloss Gottorf -
Die Modernisierung der Schleswiger Museumsinsel
von Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim
Als Schloss Gottorf vor 70 Jahren zum Museum wurde, war der Bau zuvor über ein Jahrhundert Kaserne gewesen – und hatte entsprechend gelitten. In den vergangenen Jahrzehnten wurden etliche Bausünden der Kasernenzeit rückgängig gemacht. Die Wiederherstellung des Herzoglichen Schlosses wird durch den Masterplan fortgesetzt. Der moderne Anbau zielt auf die aktuelle Bestimmung des Schlosses ab: ein für alle Bürger offenes Museum.
In keinem Jahrhundert blieb Schloss Gottorf so unberührt wie im 20. Das frühe 21. wird nun die umfangreichsten Umgestaltungen mit sich bringen, die es seit dem Bau des gewaltigen Südflügels durch Herzog Friedrich IV. gegeben hat. Doch diesmal nicht aus repräsentativen Zwecken, sondern um Schloss Gottorf endlich als das erlebbar werden zu lassen, was es vor 70 Jahren geworden ist: ein Museum im Schloss. Exklusiv wird der Herr des Hauses persönlich über den Masterplan berichten. (www.masterplan-gottorf.de)
Zum Vortragenden: Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim, geboren in Treysa, ist Direktor des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein und leitender Direktor der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf in Schleswig.
Wissenschaftliche Schwerpunkte: Archäologie Mittel- und Nordeuropas des 1. Jahrtausends, Moorfunde Südskandinaviens, die Kommunikationswege und -beziehungen nordeuropäischer Eliten der ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt, die Verbreitung römischer Militaria im Barbaricum und die frühmittelalterliche Siedlung in Haithabu.
Rückschau Vorträge 2016
Montag, den 21. November 2016 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Neue mesolithische Funde aus dem Satrupholmer Moor -
von Mirjam Briel M.A.
Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
Anlässlich einer Notbergung wurden im Satrupholmer Moor in Zentralangeln im Jahr 2016 archäologische Untersuchungen durchgeführt. Der Platz ist seit langem wegen seiner zahlreichen Fundstellen aus der Steinzeit bekannt. Es handelt sich um ein degradiertes Niedermoor mit teilweise erhaltenem Hochmoorkern. Darin eingebettet lässt sich ein, aus spätpleistozänen Toteisseen gebildeter, ursprünglich knapp 2 km² großer See nachweisen. An den Uferrändern des Satrupholmer Moores waren bereits vor dem zweiten Weltkrieg Oberflächenfundstellen mit mesolithischen Flintartefakten bekannt, und seit Beginn der Feuchtbodenarchäologie gehört es zu den wichtigen Fundarealen mit Siedlungsspuren aus dem späten Mesolithikum Schleswig-Holsteins. Zu den bedeutenden Fundplätzen gehört Satrup LA 2 am Nordufer des Moores. Durch eingespülte Kalkablagerungen sowie die überdeckenden Torfschichten bieten sich hier außerordentlich gute Erhaltungsbedingungen für organisches Material. Im Rahmen früherer Untersuchungen in den 1950er Jahren sowie in den Jahren 2010 und 2011 wurden neben zahlreichen mesolithischen Flintartefakten auch sehr gut erhaltene Tierknochen sowie mehrere Geweihgeräte gefunden. Das Fundspektrum deutet auf eine zweiphasige Nutzung des Platzes in der Kongemose und der Ertebölle Kultur hin. Die jüngsten Untersuchungen konnten eine geschlossene kongemosezeitliche Fundschicht im Uferbereich des ehemaligen Sees nachweisen, die nahezu flächendeckend mit Flintartefakten sowie einer großen Zahl ausgezeichnet erhaltener Knochen, Zähne und Geweihfragmente belegt ist.
Diese Fundschicht wird teilweise von einer jüngeren überdeckt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit der Ertebölle-Kultur zugewiesen werden kann.
Die bemerkenswert guten Erhaltungsbedingungen auf dem Fundplatz bieten auch großes Potenzial für naturwissenschaftliche Untersuchungen: Die organischen Funde ermöglichen Aussagen zu Jagdspektren, Subsistenzverhalten sowie kleinräumige Umweltrekonstruktionen.
Mirjam Briel, geboren und aufgewachsen in Hamburg und auf Sylt, studierte vor- und frühgeschichtliche Archäologie sowie Bodenkunde an der Universität Hamburg.
Nach dem Studium arbeitete sie vorwiegend in Schleswig-Holstein, zunächst als Grabungstechnikerin, bald jedoch als wissenschaftliche Grabungsleiterin in unterschiedlichen Projekten, Schwerpunkt Spätpaläolithikum/Mesolithikum. Seit August 2016 ist sie als Volontärin am Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege tätig.
Wissenschaftliche Schwerpunkte: Moorarchäologie, Spätpaläolithikum und Mesolithikum, Geoarchäologie, Eisenzeit sowie Völkerwanderungszeit und frühes Mittelalter in Mittel- und Nordeuropa.
Montag, den 31. Oktober 2016 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
EisZeiten - Die Kunst der Mammutjäger
von Dr. Michael Merkel
Archäologisches Museum Hamburg
Highlights aus weltberühmter Sammlung der Kunstkammer St. Petersburg
Dem Archäologischen Museum Hamburg ist es gelungen, noch nie außerhalb Russlands gezeigte Originale aus der Kunstkammer St. Petersburg, dem ältesten Museum Russlands, nach Hamburg zu holen. Erstmals können damit besonders spektakuläre Kunstwerke aus Mammut-Elfenbein von russischen Fundplätzen in Deutschland präsentiert werden. Die geschnitzten Figuren wurden mit großer Kunstfertigkeit geschaffen. Mammut, Löwe oder Wildpferd waren beliebte Motive der eiszeitlichen Künstler – aber auch wunderbare Frauenfiguren in vielen Varianten, die sogenannten Venusstatuetten. Seit der Auffindung der ersten Venusstatuetten der Altsteinzeit faszinieren diese die Menschen.
Die einzigartigen Leihgaben aus St. Petersburg, insgesamt gut 50 Objekte, stammen aus aus einem eiszeitlichen Jagdlager bei Kostenki, Region Voronezh (Russland), am Westufer des Don. Die Originalfunde waren bislang nur russischen Wissenschaftlern zugänglich und sind bisher noch nicht international wissenschaftlich publiziert. Sie gehören zu der weltberühmten Sammlung der St. Petersburger Kunstkammer, die nach der Eremitage das meistbesuchte Museum St. Petersburgs ist.
Die Kunst der Eiszeit ist in der Ausstellung im Archäologischen Museum Hamburg in die Darstellung der damaligen Lebens-, Klima- und Umweltbedingungen eingebettet. Der Fokus ist dabei exemplarisch auf die späte Eiszeit in Norddeutschland gerichtet, die archäologisch nach berühmten Fundstätten als Hamburger Kultur, Rissener Stufe und Ahrensburger Kultur benannt wird. Von hier aus ermöglichen Vergleiche zu den heute in der arktischen Zone lebenden Völkern Querbezüge zur Ausstellung im Museum für Völkerkunde Hamburg.
Die Ausstellung zeigt auch die einzigartige Tierwelt der Eiszeit: Mammuts, Moschusochsen und Schneehasen lebten zu dieser Zeit auch in Hamburg und waren ständige Wegbegleiter und Nahrung der frühen Menschen. Zu den beeindruckendsten Ausstellungsobjekten gehört ein fast vier Meter hohes Mammut.
Dr. Michael Merkel, Sammlungsleiter des Archäologischen Museums Hamburg und Kurator der Ausstellung, erklärt anhand von Lichtbildern einige der bedeutendsten Ausstellungsstücke.
Montag, den 26. September 2016 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Archäologie in trübem Wasser
von Dr. Jens Auer (Schwerin)
Neue Erkenntnisse zu Unterwasserstrukturen des 8. Jahrhunderts in der Schlei
Eine bei Baggerarbeiten nahe der Halbinsel Reesholm in der Schlei im Jahre 1925 entdeckte hölzerne Anlage beträchtlichen Ausmaßes wurde vom damaligen Leiter des Museums Vaterländischer Altertümer in Kiel, Friedrich Knorr, schnell als modern Befestigung der Fahrrinne abgetan und geriet bald nach Ihrer Entdeckung wieder in Vergessenheit.
Erst 1992 wurde die Anlage durch Arbeiten des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein „wiederentdeckt“ und in einer Reihe von kleineren Projekten bis 1997 teilweise erforscht. Eine erste Datierung geborgener Hölzer ergab ein Baudatum im ersten Viertel des 8. Jahrhunderts. Dr. Willi Kramer interpretierte die Unterwasserstruktur als Teil des Danewerks.
In den Jahren 2014 bis 2016 erfolgte eine Wiederaufnahme der archäologischen Feldarbeit in der Schlei. Projektpartner waren das Maritimarchäologische Programm an der Süddänischen Universität Esbjerg, das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein und die CAU zu Kiel. Neben taucherischen Arbeiten wurden mehrere geophysikalische Vermessungen durchgeführt. Zielsetzung der Arbeiten war es, sowohl den vollen Umfang der Anlage festzustellen als auch die Datierung zu bestätigen und die Konstruktion zu verstehen. Neben einer kurzen Einführung in die Forschungsgeschichte der Anlage werden die neuesten Forschungsergebnisse vorgestellt.
Zur Person: Dr. Jens Auer war als Associate Professor beim Maritimarchäologischen Programm der Süddänischen Universität tätig. Während sein Forschungsschwerpunkt auf der Archäologie von neuzeitlichen Schiffswracks liegt, ein Thema was er unter anderem in seiner Magisterarbeit und in der Doktorarbeit behandelte, gilt sein Interesse auch der Entwicklung und Verfeinerung von maritimarchäologischen Vermessungs- und Dokumentationsmethoden. Zur Zeit arbeitet er beim Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern.
„Leinen los“ mit Dr. Thorsten Lemm am 27. Juni 2016 um 18.30 Uhr
2. Termin für „Leinen los“ am 29. Juni 2016 um 18.30 Uhr
Die Archäologische Gesellschaft Schleswig-Holstein bietet Ihnen einen Vortrag auf dem Wasser an!
Im Fahrwasser der Geschichte
Die Schlei in der Wikingerzeit
Vor rund 1000 Jahren stellte die weit ins Landesinnere reichende Schlei eine bedeutende Schifffahrtsroute dar, die von Reisenden aus aller Herren Länder befahren wurde. Schon damals war auf dem Wasser, an den Ufern und in den Buchten geschäftiges Treiben zu beobachten.
Von kreischenden Möwen umschwärmte Fischer gingen ihrem Tagewerk nach. Aufsteigende Rauchschwaden aus Reet gedeckten Dächern zeugten schon aus der Ferne von kleinen Siedlungen und Gehöften der hier lebenden Menschen. Kaufleute steuerten ihre bauchigen Lastenschiffe in Richtung Haithabu, um Waren aus aller Welt an dem Ort feilzubieten, von dem der arabische Reisende At-Tartûschi um 965 n. Chr. zu berichten wusste, dass es sich um eine „sehr große Stadt am äußersten Ende des Weltmeeres“ handelte.
Auf markanten Anhöhen entlang der Schlei standen Signalfeuer, die bei akuter Bedrohung durch eine sich nähernde feindliche Flotte entfacht wurden und so einen bevorstehenden Angriff ankündigten. Zusammen mit einfachen Pfahlsperren, aber auch massiven hölzernen Befestigungen – wie z. B. die sogenannte Seesperre von Reesholm – an strategisch wichtigen Engstellen der Schlei waren sie Teil eines ausgeklügelten Verteidigungssystems, das dem Schutz Haithabus und seines Nachfolgers Schleswig diente.
Reisen Sie im Fahrwasser der Geschichte zu archäologischen Fundstellen der Wikingerzeit und des Mittelalters an und in der Schlei.
Lassen Sie sich verschiedene Aspekte dieser faszinierenden historischen Kulturlandschaft im Rahmen eines bebilderten Vortrags an Bord der HEIN näherbringen und nehmen Sie dabei selbst den Blickwinkel wikingerzeitlicher Seefahrer ein!
Zur Person: Dr. Thorsten Lemm hat in Kiel Ur- und Frühgeschichte studiert. Zur Zeit arbeitet er an einem Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft und sitzt im Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf in Schleswig.
http://www.hein-haddeby.de/
Dienstag, den 3. Mai 2016 um 19.00 Uhr
im Schleswig-Holstein-Saal im Landeshaus in Kiel
Düsternbrooker Weg 70
24105 Kiel
Innovationen der Steinzeit – Erfindung des modernen Lebens
Prof. Dr. Harald Meller
Zusammen mit der Hermann-Ehlers-Akademie, den Freunden der Antike und der Lauenburgischen Akademie für Wissenschaft und Kultur laden wir Sie herzlich nach Kiel ein!
Schirmherr: Der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages Klaus Schlie
Programm:
1. Grußwort des Herrn Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages Klaus Schlie
2. Prof. Dr. Joachim Reichstein: Ein Wort zu Prof. Dr. Harald Meller
3. Vortrag von Prof. Dr. Harald Meller
Innovationen der Steinzeit – Erfindung des modernen Lebens
Innovationen begleiten die Entwicklung des Menschen seit seinen Anfängen. Dabei ist z. B. an frühe Steinwerkzeuge bei den ersten Vertretern der Gattung homo, Bestattungsrituale beim Neandertaler und die Eiszeitkunst beim anatomisch modernen Menschen zu denken.
Der folgenreichste Einschnitt fand nach der letzten Eiszeit im Vorderen Orient statt: der Übergang von der aneignenden zur produzierenden Lebensweise durch Ackerbau und Viehzucht. Während die wildbeuterische Lebensweise durch eine überschaubare Ressourcenentnahme ökologisch stabil war und der Mensch große klimatische Krisen wie die Eiszeit gut überstand, griffen die nach Europa eingewanderten Bauern fortan durch ihre sesshafte Lebensweise umfangreich in die Natur ein.
Steigende Bevölkerungszahlen, Klimaverschlechterungen und zwischenmenschliche Konflikte bedingten immer rascher aufeinanderfolgende Innovationen, die unsere Welt bis heute prägen.
Zur Person: Prof. Dr. Harald Meller ist seit 2009 Honorarprofessor am Institut für Kunstgeschichte und Archäologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Seit 2001 ist er als Landesarchäologe und Direktor des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle tätig.
Montag, den 18. April 2016 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Die Holzkohlenfunde des ertebøllezeitlichen Fundplatzes Strande LA 163, Kreis Rendsburg-Eckernförde
von Annika Müller (Kiel)
Im Bereich Archäobotanik am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel wurde erstmals für einen mittelsteinzeitlichen Unterwasserfundplatz die Feuerholznutzung für die Mittelsteinzeit in Schleswig-Holstein untersucht. Zur Analyse kamen 450 Holzkohlen. Geborgen wurden diese bei einer gemeinsamen Lehrgrabung des Instituts für Ur- und Frühgeschichte Kiel und des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein am Rand der ertebøllezeitlichen Siedlung Strande LA 163 im Jahr 2012.
Werden verkohlte Hölzer in bestimmten Ausrichtungen gebrochen, kommen unter dem Mikroskop die für die Bestimmung einzelner Baumarten charakteristischen Zellmuster zum Vorschein. Das Holzkohlenmaterial aus Strande hat einen signifikant hohen Eichenanteil. Auch die anderen Arten sind im verkohlten Material, im Gegensatz zu den Holzfunden, in geringeren Anteilen vorhanden. Ein naheliegender Grund für den hohen Eichenanteil im Feuerholz ist das lokale Vorkommen dieser Art, denn die Landschaft Schleswig-Holsteins war zur Mittelsteinzeit von dichten Eichenmischwäldern geprägt.
Während die Hölzer zur Geräteherstellung gezielt nach Holzeigenschaften zur passenden Beanspruchung ausgewählt wurden, ist eine Selektion für die Feuerholzauswahl in Strande auszuschließen. In Strande entspricht das nachgewiesene Holzkohlenspektrum eher der Zusammensetzung des umgebenden Gehölzes und lässt den Schluss zu, dass, anders als bei der Herstellung von Holzgeräten, kein spezielles Holz verwendet, sondern das verfeuert wurde, was vor Ort in großer Menge einfach verfügbar war, nämlich Eichenholz.
Zur Person: Annika Britta Müller, geboren 1990 in Reinbek, ist die Preisträgerin des Archäologiepreises der AGSH 2015. Sie studiert seit 2009 an der CAU in Kiel Ur- und Frühgeschichte mit dem Nebenfach Geowissenschaften.
2011 absolvierte sie die Ausbildung zum geprüften Forschungstaucher und arbeitete seitdem an verschiedenen unterwasserarchäologischen Projekten. 2015 erwarb sie mit dem Vortragsthema ihren Bachelorabschluss. Ihren Masterstudienabschluss wird sie voraussichtlich im Jahr 2017 beenden.
Montag, den 21. März 2016 um 19:30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Von Haithabu nach Schleswig
Neue Forschungen zum 11. Jahrhundert an der inneren Schlei
von Dr. Volker Hilberg (Schloss Gottorf, Schleswig)
In den vergangenen Jahren haben neue Forschungen ein verändertes Bild zur Frage nach dem Untergang des wikingerzeitlichen Handelsplatzes von Haithabu und seinem Verhältnis zur neugegründeten Stadt Schleswig auf dem gegenüberliegenden Nordufer der Schlei erbracht. Durch neue Gelände- und Grabungsaktivitäten konnte erstmals Haithabus Endphase deutlich erfasst werden. Gleichzeitig begann eine Erfassung und Auswertung der großflächigen Siedlungsgrabungen in der Schleswiger Altstadt. Wie diese Forschungen unser Bild und unser Wissen von 11. Jahrhundert und dem Übergang zwischen Wikingerzeit und Mittelalter verändert haben, steht im Mittelpunkt des Vortrages.
Zum Vortragenden: Der Referent, Dr. Volker Hilberg, ist am Archäologischen Landesmuseum Schloss Gottorf für die mittelalterlichen Sammlungen zuständig, seit 2003 ist er mit der Erforschung Haithabus betraut.
Vortrag am Montag, 29. Februar 2016 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Von Waldemar dem Großen bis zum Welterbe – Danewerk und Haithabu als Werkzeuge politischer und gesellschaftlicher Legitimation
Matthias Maluck M.A. (Schleswig)
Im Jahr 1282 ließ der dänische König Waldemar der Große an seinem Grab eine Bleitafel anbringen, die das damals bereits mindestens 500 Jahre alte Danewerk zum Bollwerk für das ganze dänische Reich erklärte. Er machte damit eine Tradition der Inszenierung und politischen Instrumentalisierung des Bauwerks erstmals historisch fassbar, die bis zum heutigen Tag fortdauert. Im 19. Jahrhundert wurde das Danewerk zum Symbol des neu erfundenen Dänentums und so zu einem Schlüsselort der nationalen Identitätsfindung stilisiert. Eine vergleichbare Interpretation ließ sich bei Haithabu unmittelbar am Danewerk beobachten. Um 1897 identifizierte der dänische Archäologe Sophus Müller die wikingerzeitliche Handelssiedlung. Spätestens mit den Ausgrabungen Herbert Jankuhns unter der Ägide des SS-Ahnenerbes in den 1930 Jahren wurde dann Haithabu zum Symbolort deutsch-völkischer-nationalistischer Utopien.
Die unterschiedlichen Versuche beide Denkmale zu Zwecken der nationalen Identitätsfindung und Abgrenzung sowie der Legitimation von Herrschaft zu usurpieren, setzten sich nach dem Krieg fort und sind bis heute Grundlage für die unterschiedliche Wahrnehmung der beiden Denkmale u. a. durch Deutsche und Dänen. Nach dem 2. Weltkrieg entstanden aber auch neue Lesarten, wie z. B. die der Überwindung der nationalen Abgrenzungen und Rivalitäten. Seit 2004 wird in enger Zusammenarbeit mit der lokalen deutschen und dänischen Bevölkerung ein Antrag von Haithabu und dem Danewerk für die Aufnahme auf die UNESCO-Welterbeliste vorbereitet. Dieses Projekt verändert die Bedeutung der Denkmale im örtlichen und überregionalen Bewusstsein erneut.
Der Vortrag skizziert anhand von Haithabu und dem Danewerk, wie sich die Wahrnehmung von Bauwerken und archäologische Stätten im historischen Kontext und abhängig von der Eigensicht des Betrachters durch die Jahrhunderte bis heute geändert hatte. Dabei werden vor allem die jeweiligen Bemühungen zur politischen und gesellschaftlichen Instrumentalisierung von historischen Orten diskutiert.
Zum Vortragenden: Matthias Maluck studierte Archäologie in Heidelberg, Galway/Irland und Kiel und arbeitet seit 2005 am Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein. Er führte u. A. internationale Projekte etwa zur Erhaltung von Kulturlandschaft im Wattenmeergebiet zusammen mit Dänemark und den Niederlanden durch. Seit 2008 ist er für den UNESCO Welterbeantrag für Danewerk und Haithabu und die Pflege beider Stätten verantwortlich. Im letzten Jahr übernahm der die Leitung der Abteilung für Planung und internationale Projekte.
Rückschau Vorträge 2015
Vortrag am 26. Januar 2015 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Schuby LA 252 - Urnen, Urnen, Urnen und was dabei heraus kam
von Veronika Klems M.A. (ALSH)
Vortrag am Donnerstag, 5. Februar 2015 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Neue Untersuchungen zu den Oberflächenformen von Haithabu
Oder: Wie aus einer tiefen Schlucht das Tal des Haithabu-Baches wurde
von Prof. Dr. Hans-Rudolf Bork, Svetlana Khamnueva und Jann Wendt (Kiel)
Vortrag am 9. März 2015 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Neuorientierung auf schwankendem Grund - Archäologische Denkmalpflege in Schleswig-Holstein
von Dr. Ulf Ickerodt (ALSH)
Vortrag am 20. April 2015 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Ausgrabungen am neolithischen Ganggrab Denghoog LA 85, Sylt.
Ein Beitrag zur trichterbecherzeitlichen Gesellschaft auf den Nordfriesischen Inseln
von Maria Wunderlich M.A. (Kiel)
Vortrag am Dienstag, 19. Mai 2015 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Die früheste Landwirtschaft in Norddeutschland: Einblicke aus dem interdisziplinären Forschungsfeld der Archäobiologie
von Dr. Ulrich Schmölcke (Schleswig)
Vortrag am 29. Juni 2015 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
Zwischen Folklore und Funktionssuche - zur Neubetrachtung mittelsteinzeitlicher Hirschgeweihkappen
von Markus Wild M. A. (Schleswig)
Vortrag am 21. September 2015 um 19.30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
"Von Degen, Segeln und Kanonen - der Untergang der Prinzessin Hedvig Sofia"
Vom Schiffswrack bei Bülk zur internationalen Sonderausstellung auf Schloss Gottorf
von Thomas Eisentraut M. A. (Schleswig)
Vortrag am Montag, den 26. Oktober 2015 um 19:30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
„Die Siegesburg Rekonstruktion und Modell“
Nils Hinrichsen M. A. (Segeberg)
Vortrag am Montag, den 23. November 2015 um 19:30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
„1700 Jahre Nydamschiff“
Dr. Andreas Rau
Vortrag am Montag, den 07. Dezember 2015 um 19:30 Uhr
im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70
24864 Schleswig
„Fußabdrücke von Vormenschen in Laetoli - Die Erhaltung eines UNESCO Weltkulturerbes“
Erich Halbwidl M. A.

Hier finden Sie uns:
Geschäftsstelle der
Archäologische Gesellschaft
Schleswig-Holstein e. V.
Süderholzerstrasse 3
24986 Mittelangeln
Kontakt
Rufen Sie einfach an:
04633/9668065
oder per email:
agsh@agsh.de oder nutzen Sie
unser Kontaktformular.
Spenden
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt und trägt sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, die von der Steuer absetzbar sind. Bei größeren Beträgen wird automatisch eine Spendenbescheinigung erteilt.
Spendenkonto
VR-Bank Schleswig
IBAN: DE66 2176 3542 0014 7027 00
© Archäologische Gesellschaft Schleswig-Holstein e. V.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.